Referat 12 Berlin, 24. August 1979
Geheime Verschlußsache
MfS 020 Nr.: XI/466/79
06. Ausf. 11 Blatt
Erste Untersuchungsergebnisse über die Störabstrahlung
mechanischen Fernschreibmaschine Typ T 51
1. Gegenstand der Untersuchungen
Aufgabe der Untersuchungen war es, die Störspannungen und elektro-
magnetischen Störabstrahlungen, die von einer mechanischen Fern-
schreibmaschine abgegeben werden, qualitativ und quantitativ zu
erfassen. Besonders ging es um Störungen, die eine Information
über den auf der Fernschreibmaschine geschriebenen Text beinhalten.
Meßobjekt war der Blattschreiber Typ T 51/12-01 (Fabr.-Nr.:
10 11 33/72).
Untersucht wurden die Störspannungen, die von der Fernschreibma-
schine an die Fernschreiblinie und an das 220 V-Netz abgegeben
werden, sowie die in den Raum gesendete Störstrahlung in einem
Frequenzbereich von 100 kHz bis 1000 MHz.
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Messungen nahmen
etwa 250 Arbeitsstunden in Anspruch.
2. Charakter der Störungen einer mechanischen Fernschreib-
Maschine
Die Untersuchungen haben ergeben, daß Störspannungen bzw. -strah-
lung an die Fernschreiblinie, das Netz und in den Raum abgegeben
werden. Neben den Störungen, die vom Motor der Fernschreibmaschine
herrühren (Motorstörungen), werden auch Störungen erzeugt, die
durch die Senderkontakte hervorgerufen werden - in weiteren Fern-
schreibstörungen (FS-Störungen) genannt. Vom Empfangsmagneten aus-
gehende Störspannungen und elektromagnetische Störstrahlung konn-
ten im untersuchten Frequenzbereich nicht nachgewiesen werden.
Die FS-Störspannungen auf der Linie und auf dem Netz sowie die
Störstrahlung haben qualitativ den gleichen Charakter: Es handelt
sich um kurzzeitige HF-Schwingungen mit einem umfangreichen Fre-
quenzspektrum, deren Amplitude die Form eines Nadelimpulses mit
einer Impulsdauer von ca. 5µs aufweist.
Interessant ist, daß die FS-Störungen im Moment des
S c h l i e ß e n s der Senderkontakte entstehen (beim Übergang:
kein Strom/Strom). Die physikalische Ursache der Entstehung die-
ser Störungen konnte noch nicht geklärt werden.
Die Motorstörungen haben einen ähnlichen Charakter. Sie treten nur
zeitlich häufiger, d. h. bei jedem Schalten des Kommutators des
Motors auf.
Die einzelnen Frequenzen und die Amplituden der HF-Schwingungen
haben zufälligen Charakter. Es ließen sich aber Frequenzen ermit-
teln, bei denen die Störungen sehr häufig auftreten. Bei qualita-
tiven Angaben über die Größe der Störspannungen (in Punkt 4) wer-
den jeweils mittlere, d. h. typische Amplitudenwerte für die je-
weilige Frequenz genannt.
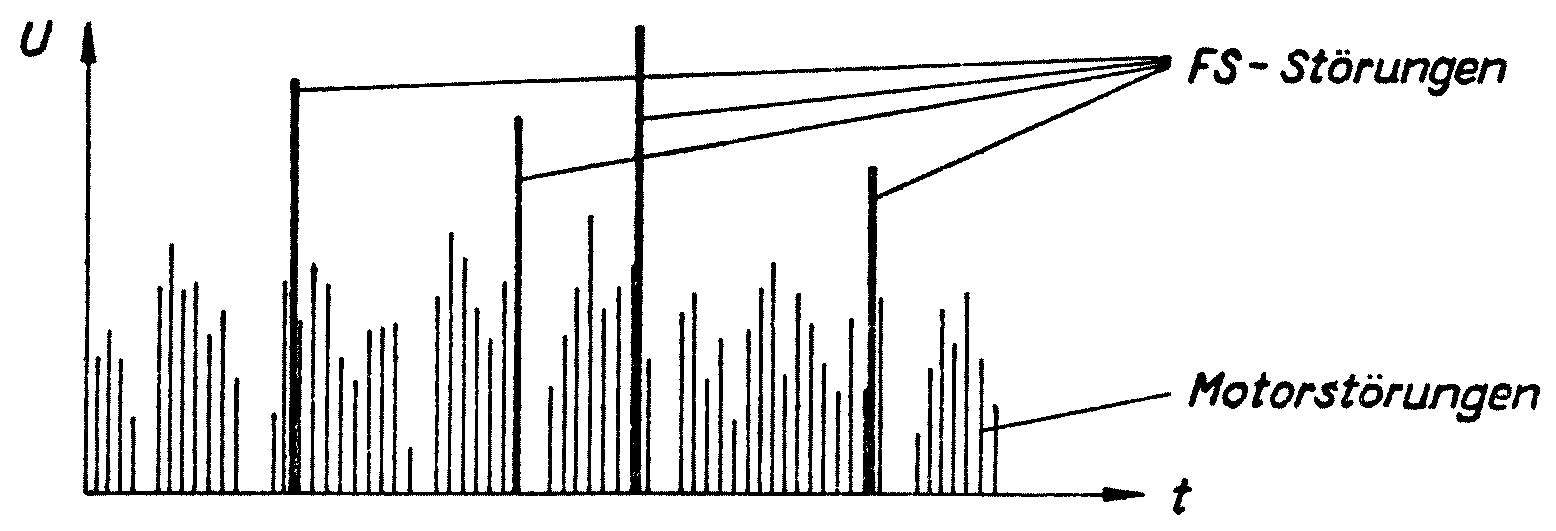
Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Motor- und FS-Störungen
bei einer Frequenz (z. B. 240 MHz)
3. Meßmethoden
3.1. Messung der Störspannung auf der Fernschreiblinie
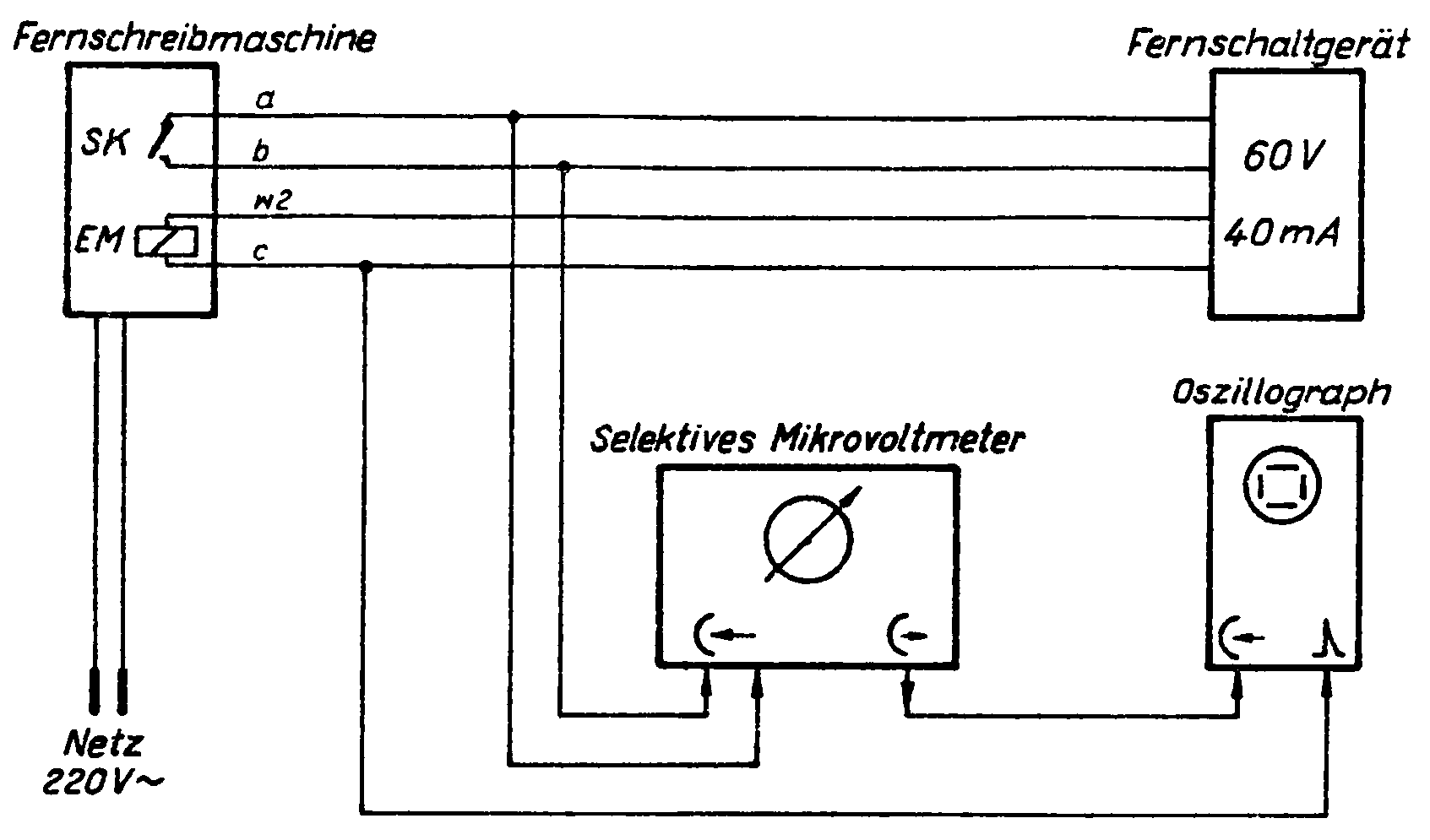
Abb. 2: Meßaufbau zur Bestimmung der Störspannung
auf der Fernschreiblinie
An die Adern "a" und "b" der Fernschreibanschlußleitung wurde ka-
pazitiv ein selektives Mikrovoltmeter angekoppelt.
Zur zeitlichen Darstellung der Störungen wurde das Signal an sei-
nem Oszillographenausgang auf einem Elektronenstrahloszillograph
sichtbar gemacht. Zur besseren Unterscheidung der FS-Störungen von
den Motor- und anderen Störungen wurde die Darstellung mit Hilfe
des Fernschreibsignals am Empfangsmagnet (EM) getriggert.
3.2. Messung der Störspannung auf dem Netz
Der Meßaufbau ist ähnlich wie auf Abb. 2, nur wurde der Eingang
des selektiven Mikrovoltmeters über einen Tastkopf direkt an eine
Phase der Netzleitung angekoppelt und gegen die Schutzerde ge-
messen.
3.3. Messung der Störstrahlung
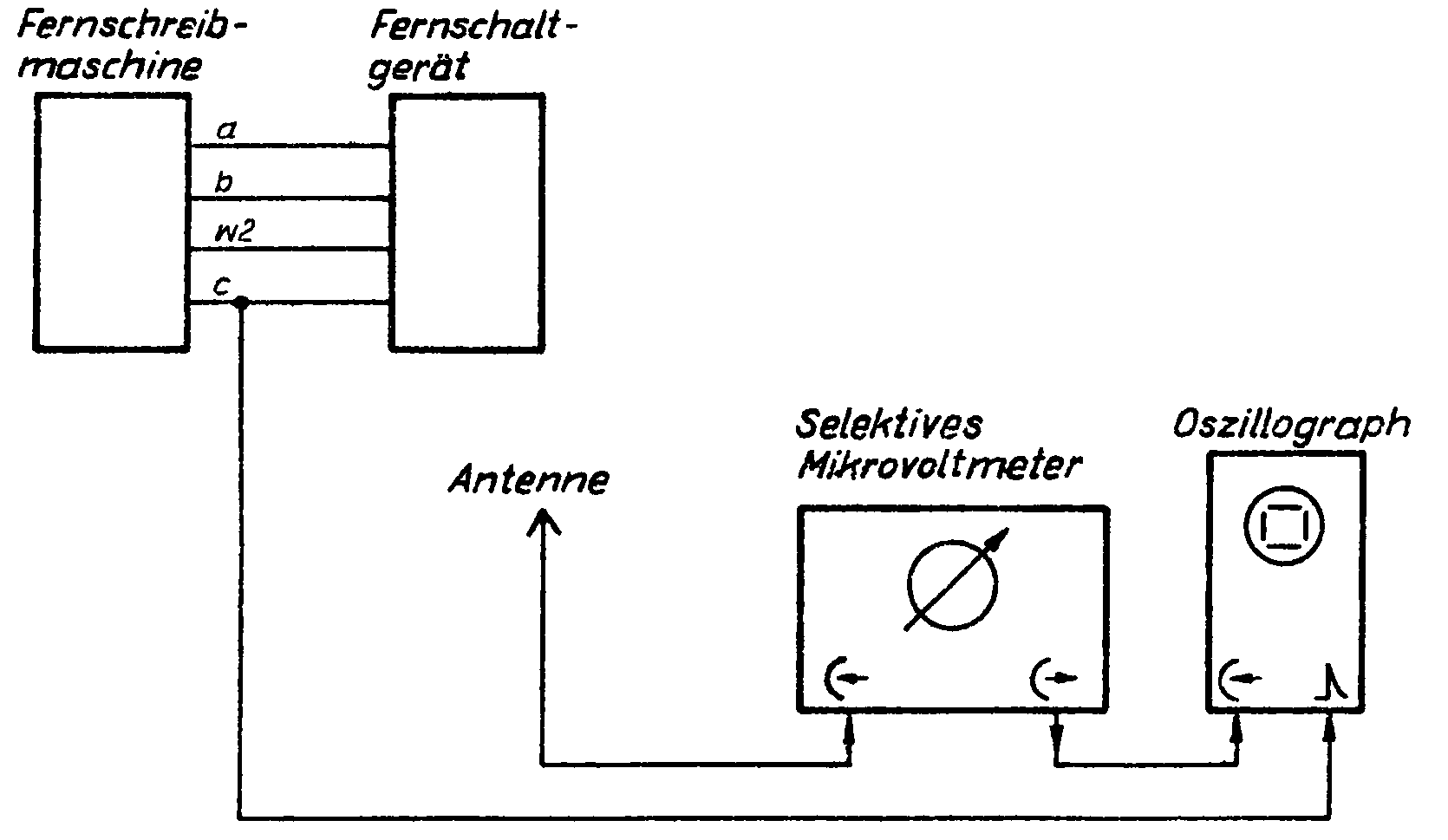
Abb. 3: Meßaufbau zur Bestimmung der Störabstrahlung
in den Raum
Der Abstand zwischen Fernschreibmaschine und Antenne betrug
etwa 4 m.
3.4. Verwendete Meßgeräte
Selektive Mikrovoltmeter
- SMV 6.5+ (0,1-30 MHZ) vom VEB Meßelektronik Berlin
- SMV 8+ (30-1000 MHz) von VEB Meßelektronik Berlin
- Frequenzanalysator 7 L 13 (1-1800 MHz) der Firma Tektronix
(FA 7 L 13)
+ Die Messungen mit den SMV 6.5 und SMV 0 wurden in der Betriebs-
art "P" gemäß der Gerätebeschreibung durchgeführt.
Antennen
- FMA 6.2 (0,1-30 MHz) vom VEB Meßelektronik Berlin
- λ/2 Faltdipol mit Anpassungsglied (240 Ω /50 Ω)
Tastkopf
- TK 102 (0,1-30 MHz) vom VEB Meßelektronik Berlin
Oszillograph
- OG 2.30 vom VEB Meßelektronik Berlin
3.5. Einschätzung der Meßgenauigkeit
Ziel war es nicht, Präzisionsmessungen auszuführen. Es ging darum,
die Größenordnung der informationshaltigen FS-Störungen zu ermit-
teln, um Aussagen über ihre Auswertbarkeit für den Gegner treffen
zu können.
Es ließen sich eindeutig Frequenzen bestimmen, bei denen die FS-
Störungen deutlich auftreten. Ihre mittlere Amplitude konnte
größenordnungsmäßig erfaßt werden.
Auf Grund des zufälligen Charakters der einzelnen Frequenzen der
HF-Schwingungen, hängt die gemessene mittlere Amplitude der Stö-
rungen stark von der Auflösungsbandbreite des selektiven Mikro-
voltmeters ab. (Bei einer Bandbreite von B = 3 MHz ist die gemes-
sene mittlere Amplitude um 25 - 30 dB höher als bei B = 30 kHz.)
Deshalb sind die Meßergebnisse des SMV 6.5 (B = 9 kHz), des SMV 8
(B = 120 kHz) und des FA 7 L 13 (B = 0...3 MHz) nicht direkt ver-
gleichbar.
Die Messungen der Störfeldstärke sind insofern ungenau, als daß
sie erstens nicht im Freifeld, sondern in einem geschlossenen
Raum durchgeführt wurden und zweitens, weil als Antenne für die
Messungen im oberen Frequenzbereich vor allen auf Grund der räum-
lichen Gegebenheiten nur ein provisorischer Eigenbaudipol verwen-
det werden konnte, dessen Daten (Antennengewinn und Wellenwider-
stand) nur ungefähr abgeschätzt werden konnten.
4. Meßergebnisse
Verwendete Symbole
UMot, EMot - mittlere Amplitude der Störspannung bzw. Störfeld-
stärke der Motorstörungen
UFS, EFS - mittlere Amplitude der Störspannung bzw. Störfeld-
stärke der FS-Störungen
f - Frequenz
+ - bezeichnet Frequenzen, bei denen die FS-Störungen
bedeutend höher sind (bis zu 20 dB) als die Motor-
störungen
- - eindeutige Messung war nicht möglich auf Grund an-
derer größerer Störungen bzw. nicht ausreichender
Empfindlichkeit der Meßgeräte
4.1. Störspannung auf der Fernschreibanschlußleitung
gemessen mit SMV 6.5
f MHz 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 30
UMot µV 63 8 2,5 1,5 0,7 0,5 1 10 57
UFS µV - 28 18 4 1,6 2 3,5 - -
+ + +
gemessen mit SMV 8
f MHz 50 80 100 140 200 300 400 440 500 1000
UMot µV 28 64 44 - 25 7 - 7 25 44
UFS µV - - 25 80 - 15 15 80 8 -
+ + + +
Bei der Messung mit dem FA 7 L 13 wurden mit einer Auflösungsband-
breite von D = 300 kHz wesentlich höhere Werte gemessen (z. T. bis
zu 1 mV).
4.2. Störspannung auf dem Netz
Mit Hilfe des SMV 6.5 (mit TK 102) ließen sich keine FS-Störungen
auf dem Netz nachweisen, da die Motorstörungen und andere (AM-Rund-
funk u. ä.) zu stark waren.
Mit dem FA 7 L 13 (B = 300 kHz) waren die Werte der FS-Störungen
um etwa 10 dB niedriger als bei der Messung an der Fernschreiban-
schlußleitung. Sie waren darüber hinaus auch bei einigen Frequen-
zen über 30 MHz deutlich sichtbar.
4.3. Störabstrahlung in den Raum
Im Frequenzbereich bis zu 30 MHz war praktisch keine FS-Störstrah-
lung nachweisbar, weder mit dem SMV 6.5 noch mit den FA 7 L 13
(jeweils in Verbindung mit FMA 6.2). Motorstörstrahlung war vor-
handen.
Zwischen 30 und 1000 MHz ließ sich die FS-Störstrahlung mit Hilfe
des SMV 8 gut nachweisen:
(Abstand Fernschreibmaschine - Antenne: 4 m)
f MHz 30 50 100 140 200 240 300 340 380 440 500 1000
EMot µV 25 8 15 5 15 8 8 2,5 2,5 2,5 8 25
EFS µV 2,5 2 25 45 2 15 45 8 15 25 15 2
+ + + +
4.4. Einfluß der Linienspannung auf die FS-Störungen
Die Fernschreiblinie wurde aus einer Batterie mit 12 V und mit 6 V
gespeist. Es wurde die Störstrahlung wie unter Punkt 4.3. bei
440 MHz untersucht.
Die Messung ergab, daß die FS-Störungen unabhängig vom Linienstrom,
aber etwa proportional zur Linienspannung sind. Bei 440 MHz erreich-
te die FS-Störfeldstärke erst bei einer Linienspannung von 6 V das
Niveau der Motorstörfeldstärke.
5. Auswertbarkeit der FS-Störungen
Beim direkten zeitlichen Vergleich der Fernschreibzeichen und der
FS-Störzeichen wurde eindeutig festgestellt, daß die FS-Störimpulse
beim Schließen der Senderkontakte entstehen. Bei der Codekombination
des Buchstaben "S" entstehen z. B. folgende FS-Störzeichen:
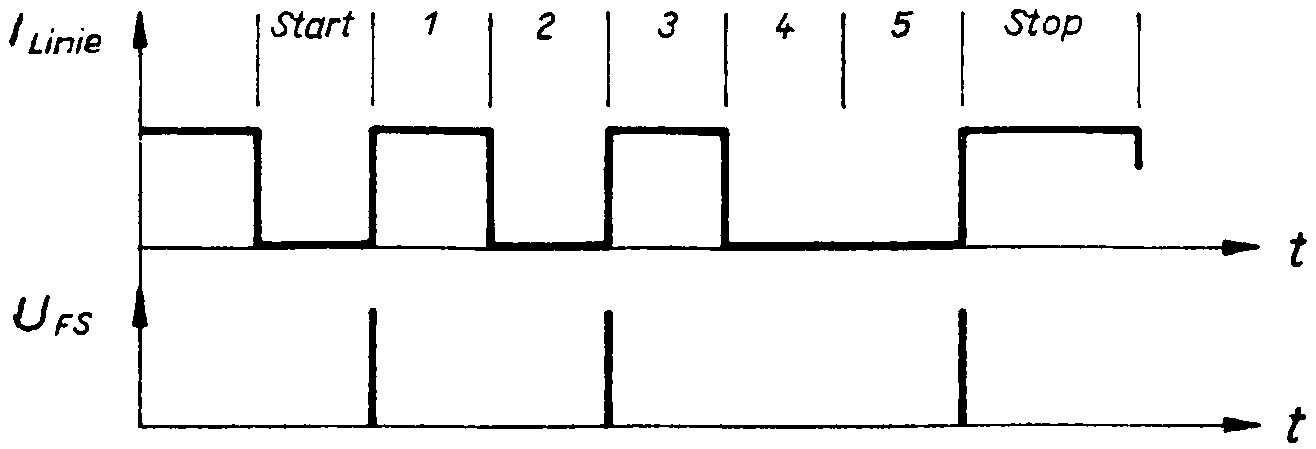
Abb. 4: Fernschreib- und FS-Störzeichen der Codekombination "S" Die Störungen traten auch dann auf, wenn es auf Grund einer feh- lerhaften Justierung einiger bestimmter Senderkontakte zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Stromflusses beim Übergang von einem zum anderen Schritt kam. Dieser Sachverhalt wird besonders deutlich bei der Codekombination "A..." (Umschaltung auf Buch- staben):
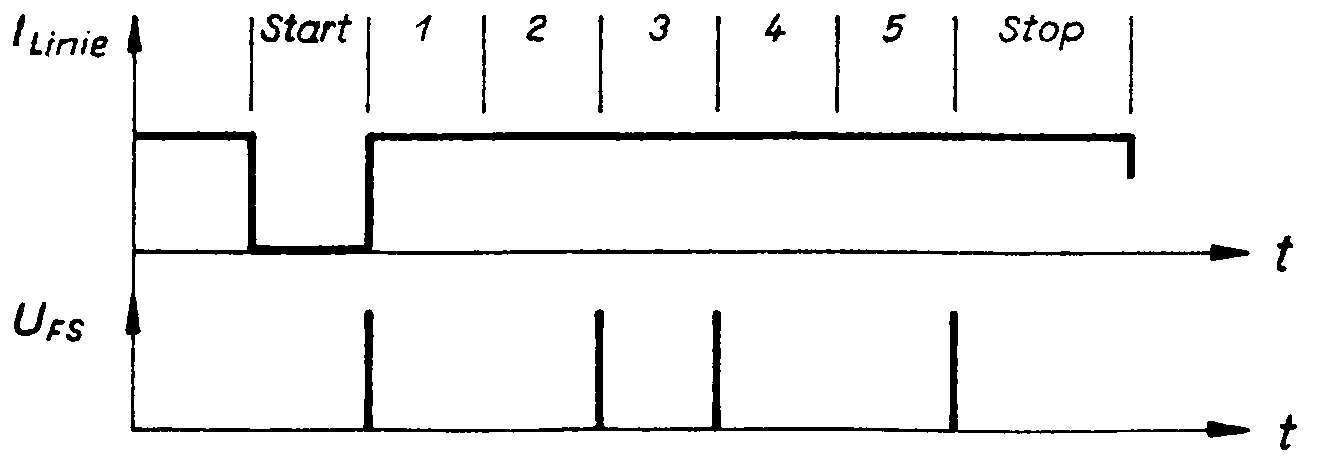
Abb. 5: Fernschreib- und FS-Störzeichen der Codekombination "A..."
Die letzten drei Störimpulse in Abb. 5 sind das Ergebnis einer
fehlerhaften Justierung bestimmter Senderkontakte und somit exem-
plarspezifisch. Bei einer anderen Fernschreibmaschine können sie
bei anderen Schritten oder auch gar nicht auftreten.
Für jede Codekombination des Telegraphenalphabets wurden das Fern-
schreib- und das FS-Störzeichen aufgezeichnet. Es zeigte sich, daß
innerhalb des gesamten Alphabets (32 Codekombinationen) 18 ver-
schiedene Störimpulsfolgen auftreten. Die Tabelle zeigt die Auf-
teilung der Codekombinationen auf die 18 Störimpulsfolgen:
FS-Störimpuls- Codekombination
folge Buchstabenregister Ziffern- u. Zeichenregister
1 A E - 3
2 B D J 1... ? Wer da?
3 C V : =
4 F K X A... ( /
5 G R 4
6 H
7 I 8
8 L )
9 M N . ,
10 O 9
11 P 0
12 Q Y 1 6
13 S U ' 7
14 T 5
15 W Z 2 +
16
17 Zwischenraum
18 32.
Werden die Störimpulsfolgen, die während des Schreibens auf der
Fernschreibmaschine ausgesendet worden, aufgezeichnet, lassen sich
eventuell durch Kombinieren - die richtige Zuordnung der Codekon-
binationen zu den Störimpulsfolgen ermitteln und anschließend rela-
tiv leicht der geschriebene Text rekonstruieren.
Eine erfolgreiche Auswertung der abgestrahlten FS-Störungen ist
also im Prinzip möglich. Da die Störimpulsfolgen exemplarspezi-
fisch sind, kann auch die Zuordnung der Codekombinationen zu den
Störimpulsfolgen unterschiedlich sein. Es läßt sich also unter
Umständen auch der Absender der Nachricht ermitteln.
6. Einschätzung der Anwendbarkeit der Fernschreibmaschine T 51
im Chiffrierbetrieb - Schlußfolgerungen für weitere Unter-
suchungen
Die Untersuchungsergebnisse des Fernschreibmaschinentyps T 51
zeigen, daß sein Einsatz zur Klartexteingabe im Vor- und Direkt-
chiffrierbetrieb recht problematisch ist. Die Existenz von Stör-
spannungen auf dem Linienausgang bei unteren Frequenzen zwingt zu
der Forderung, daß angeschlossene Direktchiffriergeräte bis zu
etwa 30 MHz, aber auch darüber hinaus, eine hohe Übersprech-
dämpfung besitzen müssen.
Bei höheren Frequenzen überwiegt die direkte Abstrahlung in den
Raum. Hier ließen sich bei dem untersuchten Exemplar drei Frequen-
zen feststellen (140, 300 und 440MHz), bei denen die FS-Störfeld-
stärke recht groß und die Motorstörfeldstärke wesentlich kleiner
ist. (Zum Vergleich: Die unter den gleichen Bedingungen gemessene
Feldstärke des Senders "Berliner Rundfunk" - UKW Berlin 91,4 MHz -
beträgt 3 mV/m. Die FG-Störstrahlung der Fernschreibmaschine ist -
in einer Entfernung von 4 m bei 100 MHz und 440 MHz also nur
etwa 100 mal kleiner als die UKW-Senderfeldstärke.) Die FS-Stör-
zeichen sind hier leicht zu isolieren und auszuwerten.
Die Störstrahlung von solch hohen Frequenzen induziert sich leicht
auf in der Nähe befindliche Installationseinrichtungen (Zentral-
heizung, Wasserleitungen, Netz- und andere elektrische Leitungen
usw.) und breitet sich über diese unkontrolliert auch über die
gesicherte Zone hinaus. Eventuell kann dabei die weitere Ab-
strahlung in den Raum begünstigt werden.
Es ist daher notwendig, die Störabstrahlung zu verringern. Das
müßte sich durch eine niedrigere Linienspannung, die von dem an-
geschlossenen Chiffriergerät zu liefern wäre, sowie durch eine
bessere Abschirmung der Fernschreibmaschine realisieren lassen.
Der Niedrigspannungsbetrieb ist noch genauer zu untersuchen, indem
man eine Senderwelle mit einem störfreien Motor betreibt. Um zu-
sätzlich äußere Störeinflüsse auszuschalten, wäre es günstig, die-
se Messungen in einem abgeschirmten Käfig durchzuführen. (Unter
solchen Bedingungen, d. h. störfreier Motor und Messung im Käfig,
sollte auch die an die Netzleitung abgegebene FS-Störspannung
noch einmal untersucht werden.) Außerdem ist zu prüfen (Konsulto-
tion mit dem Hersteller), wie weit die Linienspannung und der
Linienstrom heruntergesetzt werden können.
Es sollte geprüft werden, ob durch einfache konstruktive Maßnah-
men an der Fernschreibmaschine T 51 die Störabstrahlung verringert
werden kann.
Außerdem sollte der Fernschreibmaschinentyp T 61 untersucht werden,
da dessen Metallgehäuse eventuell die Störstrahlung etwas zurück-
hält.
Zur umfassenderen quantitativen Einschätzung der Störstrahlung
sind entsprechende Messungen mit einem empfindlichen breitbandigen
selektiven Empfänger in Verbindung mit einer guten Antenne im
Freifeld vorzunehmen. Dazu ständen uns z. Z. das SMV 8 und die An-
tenne LPA 1 zur Verfügung. Die FS-Störstrahlung dürfte mit diesen
in einer größeren Entfernung von der Fernschreibmaschine als 4 m
nachweisbar sein. Es ist darüber hinaus zu vermuten, daß mit einem
besseren Empfänger (höhere Bandbreite und Empfindlichkeit) der
eventuell speziell zu derartigen Zwecken entwickelt wurde - der
Nachweis und die Auswertung der FS-Störstrahlung in noch größerer
Entfernung (über 20 m) möglich sind. Ein derartiges Gerät ist uns
im Augenblick nicht bekannt, dürfte aber technisch durchaus -
wenn auch mit hohem Aufwand - zu realisieren sein.
Generell noch gar nicht wurde untersucht, ob die Auswertung der
FS-Störstrahlung oder -spannung auf dem Netz mit gänzlich anderen,
in der Meßtechnik erst im Kommen befindlichen Meßmethoden möglich
ist (z. B. Korrelationsmeßverfahren).
Ebenfalls ist zu erwarten, daß besonders der Empfangsmagnet auch
magnetische Abstrahlungen im NF-Bereich verursacht. Das müßte zu
einer umfassenden Gesamteinschätzung des Abstrahlungsproblems
einer mechanischen Fernschreibmaschine auch untersucht werden.
Sollten Niedrigspannungsbetrieb und konstruktive Veränderungen
nicht die gewünschten Resultate bringen, wäre die Anwendung der
mechanischen Fernschreibmaschine Typ T 51 im Chiffrierbetrieb nur
im Faradayschen Käfig möglich.
Eisenträger
Leutnant
Abteilung XI Berlin, 19. Januar 1983
Vertrauliche Verschlußsache
VVS-o020
MfS-Nr.: XI/052/83
02. Ausf. Bl. 01 bis 02
E i n s c h ä t z u n g
der Abstrahlungssicherheit der bei der Abteilung XII als // Abteilung XII (Auskunft, Speicher, Archiv)
Datenerfassungsgeräte eingesetzten elektromechanischen
Fernschreibendplätze
An den fünf Fernschreibendplätzen in der vorliegenden Konfigu-
ration (Fernschreibmaschine T 51 und Lochstreifensender T 53 im
Lokalbetrieb über Fernschaltgerät T 57; Linienanschlußkabel hängt
frei herunter) wurden sowohl vom Hersteller, als auch vom Instal-
lateur keine Maßnahmen gegen kompromittierende Abstrahlung ge-
troffen. Beim Schalten der Sendekontakte der FSM T 51 und des
LS T 53 entstehen Abrißfunken und damit im Zusammenhang kurze
Hochfrequenzimpulse in einem breiten Frequenzspektrum (einige
MHz bis ca. 500 MHz), die sich räumlich als elektromagnetische
Strahlung und als Funkstörspannungen auf der Netzzuleitung, auf
anderen in der Nähe der Endplätzen vorbeiführenden Leitungen so-
wie Wasser- und Heizungsinstallation ausbreiten. Sie haben kom-
promittierenden Charakter.
Aufgrund der Aufstellung der Endplätze in der 6. Etage des Dienst-
gebäudes (Zwischenbau) und bereits vorhandener Untersuchungsergeb-
nisse über die Abstrahlung von T 51/T 53 ist davon auszugehen, daß
die elektromagnetische Abstrahlung zumindest in den Wohnhäusern der
Ruschestraße noch empfangen und ausgewertet werden kann (es besteht
optische Sicht, Entfernung ca. 150 m), u. U. auch noch in Entfer-
nungen von über 300 m.
Auf dem 200 V-Netz und anderen elektrischen und technischen In-
stallationen dürfte die Funkstörspannung im gesamten Dienstgebäude
nachweisbar sein, wobei in größerer Entfernung vom Aufstellungsort
(etwa ab 50 - 100 m Leitungslänge) die Identifizierung der Stör-
spannungsimpulse infolge anderer im Dienstobjekt erzeugter Funk-
strörungen sehr schwierig (u. U. aber nicht unmöglich) ist.
Die Verhinderung der Ausbreitung der kompromittierenden Abstrah-
lung der Endplätze über den Betriebsraum hinaus ist mit einfachen
Mitteln nicht möglich. Aus diesem Grunde werden folgende Maßnahme-
vorschläge unterbreitet, durch deren Umsetzung eine Reduzierung
der Reichweite der kompromittierenden Abstrahlung auf etwa 20 %
der derzeitigen Werte erzielt wird:
1. Realisierung eines Niedrigpegelbetrieb für T 51 und T 53,
d. h. Reduzierung der Telegrafiespannung auf 15 V durch Ver-
wendung einer zusätzlichen Stromversorgung mit Strombegren-
zung anstelle des Fernschaltgerät T 57. Die Nutzung einer
gemeinsamen Stromversorgungseinheit für alle fünf Endplätze
ist möglich.
2. Schirmung der Telegrafie- und Netzkabel der Fernschreibmaschi-
nen und Lochstreifensender sowie der Gleichspannungs- und Netz-
kabel der Stromversorgungseinheit.
3. Einhalten eines Mindestabstandes von 1 m von den Geräten und
Kabeln der Endplätze zu allen anderen Fremd Kabeln, Geräten
und technischen Einrichtung (einschließlich Heizung und Was-
serleitung)
4. Da es sich im vorliegenden Fall um nur fünf konkrete Fern-
schreibendpläze handelt, scheinen zur weiteren Reduzierung
der kompromittierenden Abstrahlung folgende zusätzliche kon-
struktive Änderung an den Geräten ökonomisch vertretbar;
wobei die Austauschbarkeit der Geräte bei Ausfällen nicht
mehr gegeben ist:
Bei T 51 und T 53:
- Anschluß eines Funkenlöschkondensators (C ≥ 33 nF, verlust-
arm) direkt an Sendekontakte,
- Schirmung der Adern (a, b) von den Sendekontakten bis zum
Linienfilter;
zusätzlich bei T 53:
- Demontage des Gegenschreibmagneten KM 1,
- Demontage des Steueranschlußkabels (wenn vorhanden).
Nach der Realisierung sämtlicher im vorliegenden Dokument genann-
ten Maßnahmen ist nach gegenwärtigem Erkenntnisstand eine Aus-
wertung der kompromittierenden Abstrahlung der Fernschreibend-
plätze außerhalb des Dienstobjektes mit Sicherheit nicht möglich.
Unter Berücksichtigung des relativ hohen allgemeinen Funkstör-
pegels im Objekt dürfte auch die Auswertung im Abstand < 30 m
vom Aufstellungsort nahezu undurchführbar sein.
Abteilung XI Berlin, 10. Juli 1981
Geheime Verschlußsache
GVS-o020
MfS-Nr.: XI/215/81
07. Ausf. Bl. 1 bis 59
Untersuchung zur kompromittierenden
Abstrahlung an elektronischen Fern-
schreibmaschinen des Systems F 1000
des VEB Kombinats Meßgerätewerk Zwönitz
Inhaltsübersicht
1. Einleitung
2. Optische Abstrahlung
2.1. Überblick
2.2. Auswertebeispiel
2.2.1. Versuchsaufbau
2.2.2. Ergebnisse
2.3. Auswertemöglichkeiten
2.4. Verhinderung der kompromittierenden optischen Abstrahlung
3. Akustische Abstrahlung
3.1. Überblick
3.2. Auswertebeispiel Druckernadeln
3.2.1. Versuchsaufbau
3.2.2. Ergebnisse
3.3. Auswertemöglichkeiten
3.3.1. Versuchsaufbau
3.3.2. praktische Auswertemöglichkeiten
3.3.3. Einfluß des Grundgeräuschpegels
3.3.4. Einfluß der Meßentfernung
3.4. Verhinderung der kompromittierenden akustischen Abstrahlung
4. Abstrahlung durch Stromaufnahmeänderungen
4.1. Ursachen kompromittierender Stromaufnahmeänderungen
4.2. Auswertebeispiel der Stromaufnahmeänderung
4.2.1. Versuchsaufbau
4.2.2. Ergebnisse
4.3. Auswertemöglichkeiten
4.3.1. Allgemeines
4.3.2. Einfluß weiterer Verbraucher der FSM F 1000
4.3.3. Einfluß der Meßentfernung und zusätzlicher Verbraucher
4.4. Verhinderung der kompromittierenden Stromaufnahmeänderungen
5. Funkstörungen
5.1. Überblick
5.2. Messung der Funkstörungen nach TGL 20885
5.3. kompromittierende Funkstörungen
5.3.1. allgemeine Meßbedinungen
5.3.2. Funkstörungen der Druckermagnete und ihrer
Ansteuerschaltung
5.3.3. Funkstörungen der Eingabetastatur und Tastaturlogik
5.3.4. weitere kompromittierende Funkstörungen
5.4. Funkstörungen ohne Informationsgehalt
5.4.1. Funkstörungen der Netzteile
5.4.2. Funkstörungen durch Taktoberwellen
5.4.3. Funkstörungen durch Schrittmotore
5.4.4. Funkstörungen durch den Lochbandstanzer
5.5. Möglichkeiten der Selektion kompromittierender
Funkstörungen am F 1000
5.5.1. Allgemeines
5.5.2. Amplituden - Frequenzverlauf der Funkstörungen
als Selektionskriterium
5.5.3. Energieverteilung der Funkstörungen als
Selektionskriterium
5.5.4. Zeitliche Zuordnung von Funkstörimpulsen als
Selektionskriterium
5.6. Ausbreitungsmöglichkeiten der Funkstörungen
5.6.1. Funkstörspannungen auf Netz
5.6.2. Funkstörspannungen auf der Telegrafieanschlußleitung
5.6.3. Funkstörspannungen auf den Anschlußleitungen zum
Fehlerkorrekturgerät
5.6.4. Funkstörfeldstärke
5.7. Funkentstörmaßnahmen
5.7.1. Zielstellungen
5.7.2. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen an der FSM F 1000
5.7.3. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen am Gesamtsystem
6. Sonstige auswertbare Energien
7. Zusammenfassung
8. Abkürzungen
9. Literaturverzeichnis
Anlage 1 Druckbilder F 1100
Anlage 2 Meßprotokolle über die Messung von
Funkstörungen F 1100
Anlage 3 Funkstörspannungsanteile einzelner
Störquellen der FSM F 1100
Anlage 4 Funkentstörmaßnahmen F 1000
Anlage 5 Stromlaufplan EN/1
Anlage 6 Anschlußplan ADo-8
Anlage 7 Netzleitungsfilter
1. Einleitung
In Fortführung von Untersuchungen an elektronischen Fernschreib-
maschinen (FSM) des Systems F 1000 (siehe /1/) zwecks Beurteilung
ihrer Sicherheit gegen kompromittierende Abstrahlung1) wurden
weitere umfangreiche Messungen an FSM der Familie F 1300 (K4-
Muster F 1301) und F 1100 (Vorseriengeräte) durchgeführt. In den
Abschnitten 2 bis 5 werden insbesondere kompromittierende Ener-
gien durch
- optische Abstrahlung
- akustische Abstrahlung
- Stromaufnahmeänderungen
- Funkstörungen
untersucht. Entstehung, Ausbreitung, absolute Größen, Empfangs-
möglichkeiten und Vorschläge zur Reduzierung solcher Energien
werden aufgezeigt. Die Informationsrückgewinnung wird durch
praktische Beispiele demonstriert, Möglichkeiten ihrer Verhinde-
rung werden genannt.
Im Abschnitt 6 werden weitere, hier nicht untersuchte, kompro-
mittierende Energien aufgezählt. Probleme zur kompromittierenden
Abstrahlung, die in Zusammenarbeit mit anderen Geräten und An-
lagen auftreten, sind ebenfalls noch nicht untersucht. Es sei
hier auf /2/ und /3/ verwiesen.
1) kompromittierende Abstrahlung: Sammelbegriff für alle informa-
tionshaltigen Energien, die während der Ver- oder Bearbeitung ge-
heimzuhaltender Informationen mittels technischer Geräte entstehen
und sich unbeabsichtigt ausbreiten können, so daß durch den Em-
pfang dieser Energien und ihrer Analyse Rückschlüsse auf den In-
halt der verarbeiteten Information möglich sind.
2. Optische Abstrahlung
2.1. Überblick
Die Betriebsbereitschaftsanzeige der FSM und die fünf Kontroll-
anzeigen für die Markierungsmagnete des Lochbandstanzers (LBS)
sind informationsbehaftet. Die Kontrollanzeigen befinden sich
auf den Karteneinschüben (KES) im Inneren des LBS, von außen
also nicht sichtbar. Alle übrigen Anzeigen des Tastenfeldes, der
Lochbandeinheit und des Grundgerätes sind nicht informationsbe-
haftet.
Die Betriebsbereitschaftsanzeige, eine LED VQA 23, befindet sich
an der Frontplatte des Grundgerätes über dem Sondertastenfeld.
Sie leuchtet, wenn
- Netzspannung vorhanden ist
- Fernschreibpapier eingelegt ist
- keine Störungsmeldung vorliegt
- Linienstrom fließt (Schreibruhezustand)
Sie flackert im Rhythmus der gesendeten bzw. empfangenen Zeichen
(ITA Nr.2).
Die VQA 23 hat eine Lichtstärke von ≥0,6 mcd (I = 20 mA) bei
einer Wellenlänge von 560 nm.
2.2. Auswertebeispiel
2.2.1. Versuchsaufbau
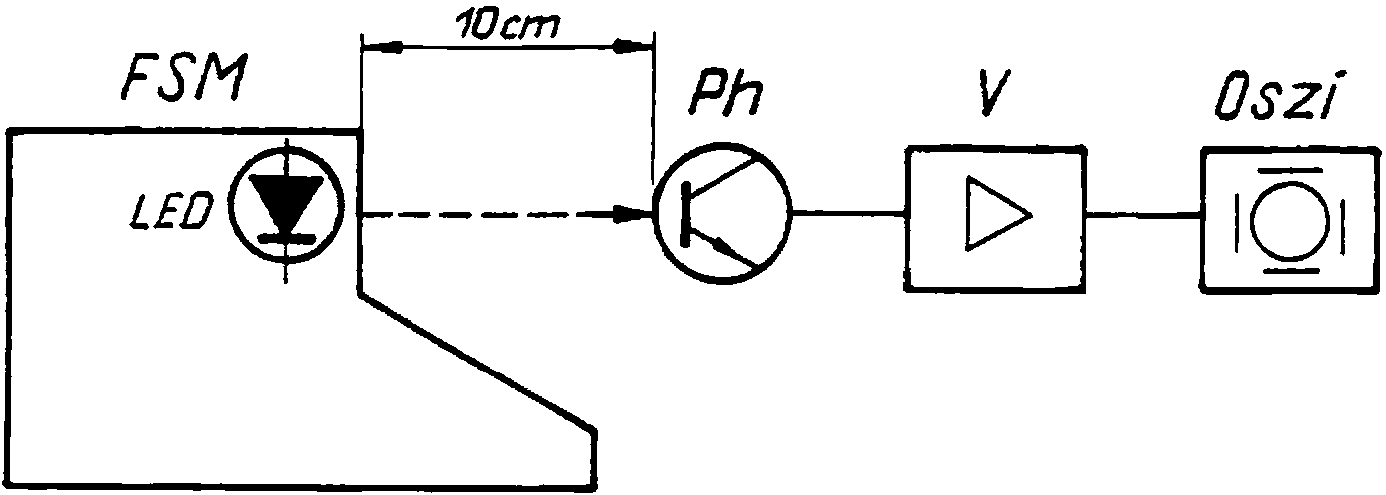
Ph Fototransistor (BPY61) V Verstärker Oszi Speicheroszilloskop FSM Fernschreibmaschine Bild 1 Auswertung der optischen Abstrahlung (Prinzip) 2.2.2. Ergebnisse
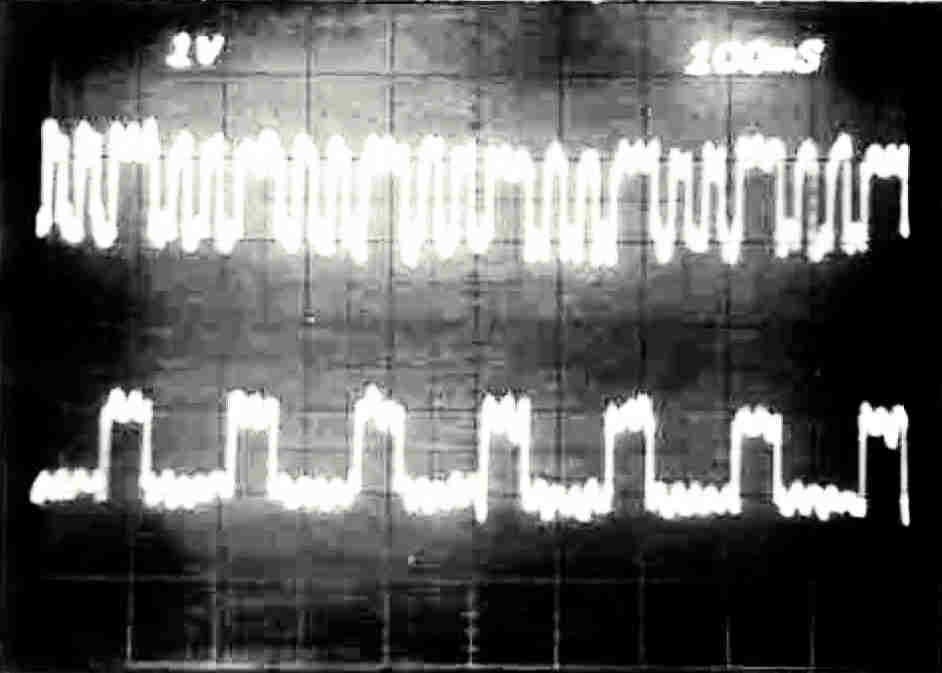
Bild 2 Zeichen Nr. 25 und 20 des - ITA Nr. 2
(oben Buchstabe y unten Buchstabe t)
diffuses Tageslicht
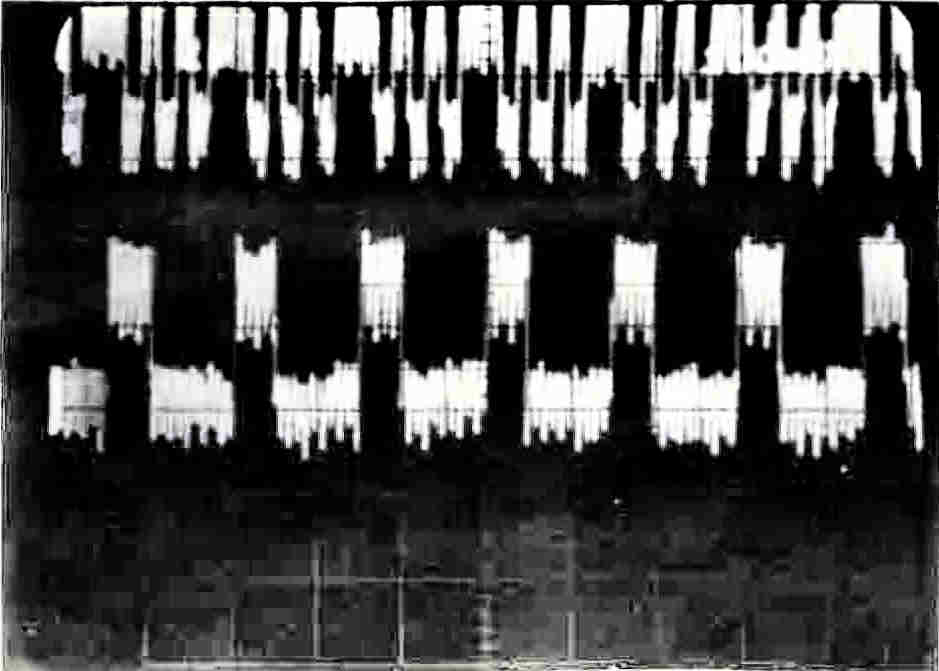
Bild 3 wie Bild 2, mit Zusatzbeleuchtung
(Leuchtstoffröhren )
Die Bilder 2 und 3 beweisen, daß auf kurze Entfernungen eine Aus-
wertung möglich ist, wobei die von der FSM gesendeten bzw.
empfangenen Zeichen vollständig zurückgewonnen werden können.
2.3. Auswertemöglichkeiten
Bei Einsatz von höchstempfindlicher Optoelektronik, Sekundäremis-
sionvervielfachern, Lawinenphototransistoren, optischen und
elektronischen Filtern u. s. w. lassen sich größere Abstände rea-
lisieren. Erfahrungen hierzu liegen nicht vor. Es ist jedoch ein-
zuschätzen, daß selbst bei günstigsten Bedingungen (optische
Achse, Nachts) keine Auswertung aus größere.n Entfernungen möglich
ist.
2.4. Verhinderung der kompromittierenden Abstrahlung
Sie ist durch eine Änderung an der FSM F 1000 (Beseitigung der
Tastung der LED V1 durch den Zeichenstrom ise1) bzw. durch ent-
sprechende Betriebsvorschriften (Strahlungswinkel LED nicht auf
Fensterfront richten bzw. fensterlose Räume, diffuse Fensterschei-
ben u. ä.) zu erreichen.
3. Akustische Abstrahlung
3.1. Überblick
Beim Auftreten der Druckernadeln auf Farbband, Papier und Druck-
walze wird eine kompromittierende akustische Abstrahlung erzeugt.
Die Schallimpulse treten analog zu den Druckpunkten im Frequenz-
raster 133 Hz auf, wobei ein Zeichen durch 5 Druckschritte und
3 Leerschritte charakterisiert ist.
Die Intensität der Schallimpulse ist von der Anzahl gleichzeitig
angesteuerter Nadelmagnete abhängig. (0 bis maximal 7 angesteuerte
Magnete in einer Spalte, siehe Anlage 1)
Teilt man die Druckzeichen in Klassen ein, wobei jeweils solche
Zeichen einer Klasse angehören, bei denen die Anzahl der Druck-
punkte entsprechender Druckspalten übereinstimmen, so sind theo-
retisch die verschiedenen Klassen durch Auswertung der akusti-
schen Abstrahlung unterscheidbar (siehe Anlage 1).
Weitere Quellen der Abstrahlung, wie
- Klingel
- Tastatur
- Druckwagenantrieb einschließlich Kupplung und Bremse
- Leserschrittmotor
- Stanzer mit Transport- und Stanzerantrieb,
haben keinen bzw. nur einen geringen Informationsgehalt und brin-
gen keinen weiteren Informationsgewinn.
3.2. Auswertebeispiel Druckernadeln
3.2.1. Versuchsaufbau
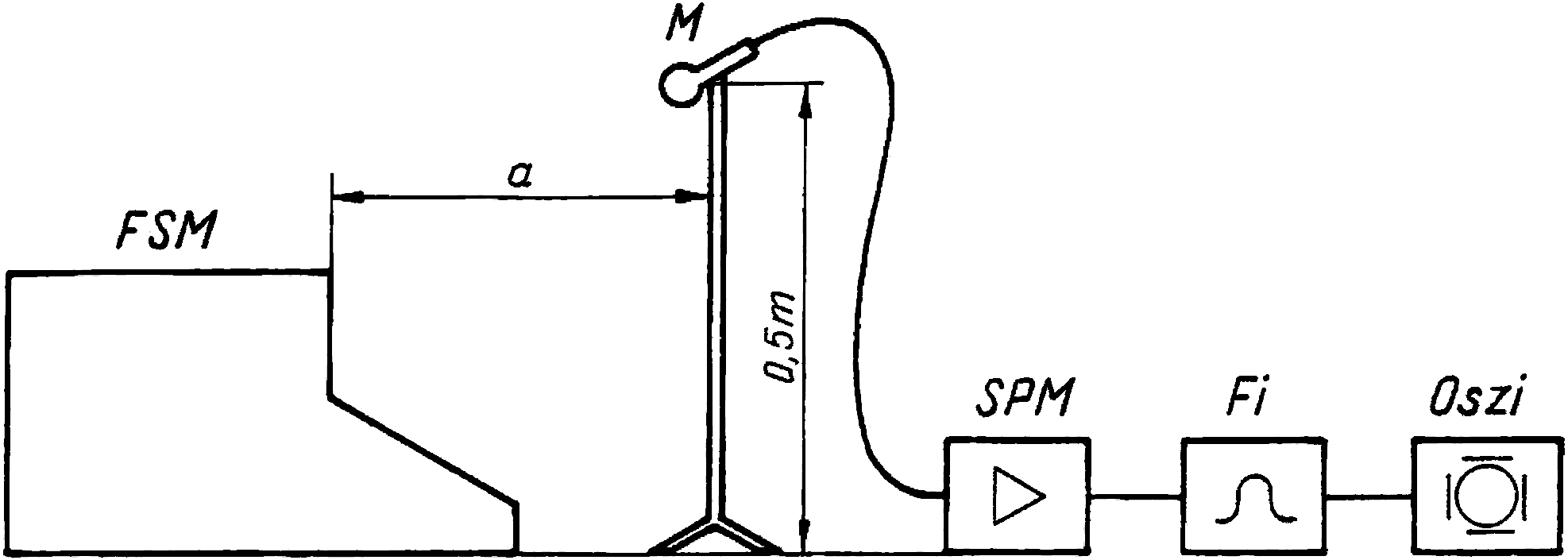
FSM Fernschreibmaschine F 1100 M Kugelmikrofon 1/2" SPM Schallpegelmesser EZGN BN45031 Fi Bandpaß SM24/SM27 Oszi Speicheroszilloskop 7623A Bild 4 Nachweis der Schallimpulse 3.2.2. Ergebnisse
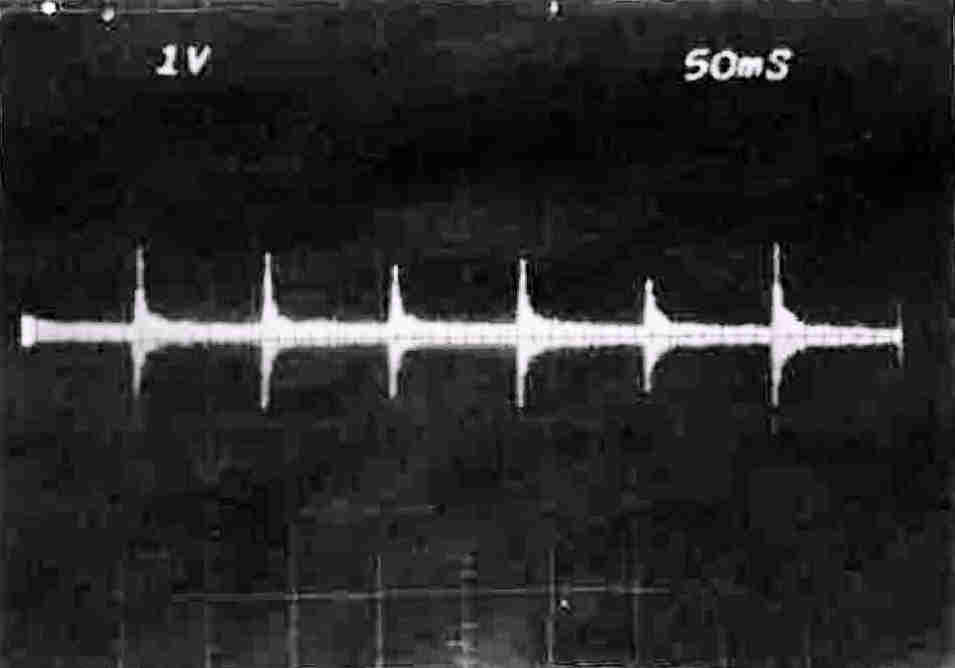
Bild 5 Oszillogramm gedruckte Zeichen: .(Punkt)
100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m
Grundgeräuschpegel 66 dB

Bild 6 Oszillogramm gedruckte Zeichen: lat.
Kleinbuchstabe j
100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m
Grundgeräuschpegel 66 dB
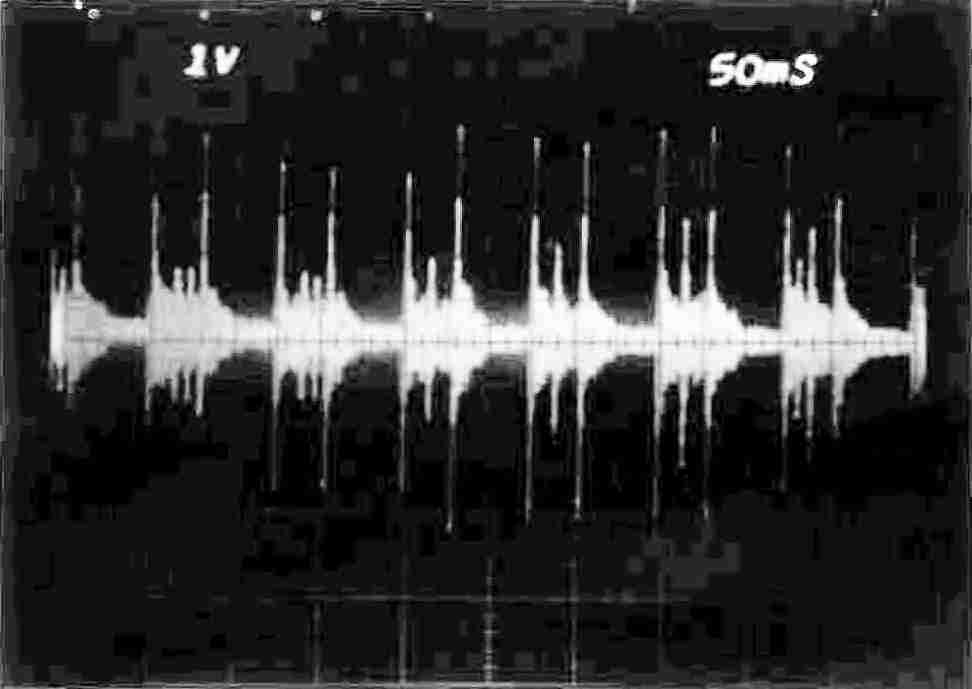
Bild 7 Oszillogramm gedruckte Zeichen: lat.
Kleinbuchstabe v
100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m
Grundgeräuschpegel 66 dB
Die Bilder 5, 6 und 7 belegen die prinzipielle Auswertemöglichkeit
der akustischen Abstrahlung der Druckernadeln. Die Druckraster-
frequenz 133 Hz (7,5 ms) ist eindeutig erkennbar, die Schallinten-
sität schwankt jedoch beim Druck gleicher Buchstaben.
3.3. Auswertemöglichkeiten
3.3.1. Allgemeines
Bisher liegen keine Erfahrungen auf diesem Gebiet vor. Die er-
zielten Ergebnisse am F 1100 zeigen, daß dem Problem akustische
Abstrahlung entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen ist. Der ab-
solute Impulsschallpegel des F 1100 schwankt zwischen 48 dB(A)
für das Zeichen Punkt (.) und 57 dB(A) für den Buchstaben m
(gemessen mit Präzisionsimpulsschallpegelmeßgerät PSI 202, Leser
und Stanzer abgeschaltet, Meßabstand 2 m).
Durch den Einsatz hochempfindlicher Richtmikrofone, Körperschall-
aufnehmer, elektronischer Verstärker und Filter, sowie mit Anwen-
dung von Korrelationsmeßverfahren könnte die Auswertung auf große
Entfernungen bzw. durch Fenster und Wände möglich sein, was nach-
folgende Untersuchungen verdeutlichen.
Zu beachten sind weiterhin die Möglichkeiten der Laser-Radaraus-
wertung schwingender Fensterscheiben.
3.3.2. Praktische Auswertemöglichkeiten
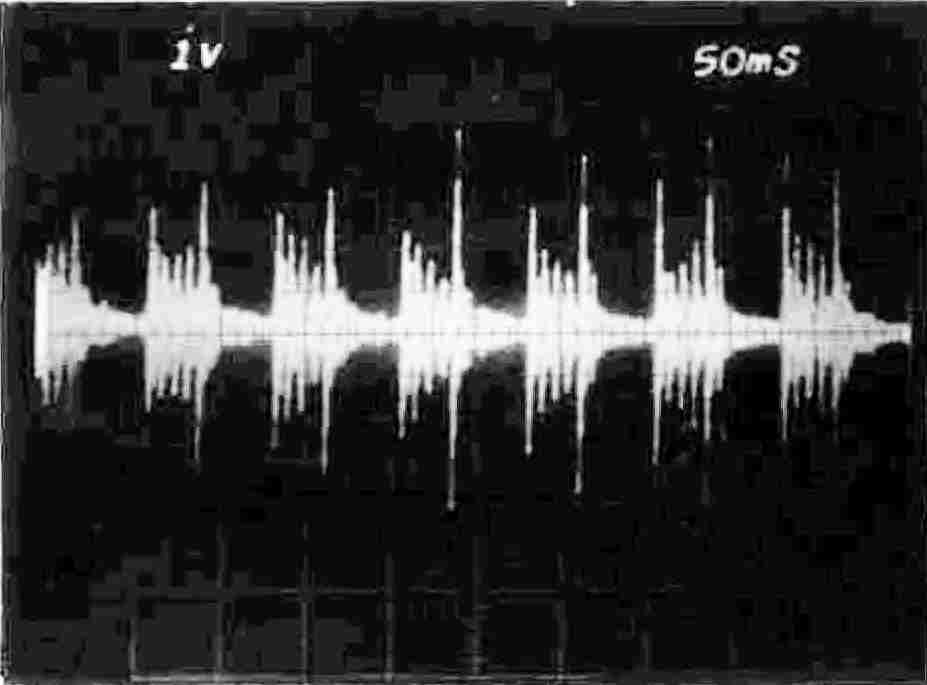
Bild 8 Oszillogramm lat. Kleinbuchstaben u
100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m
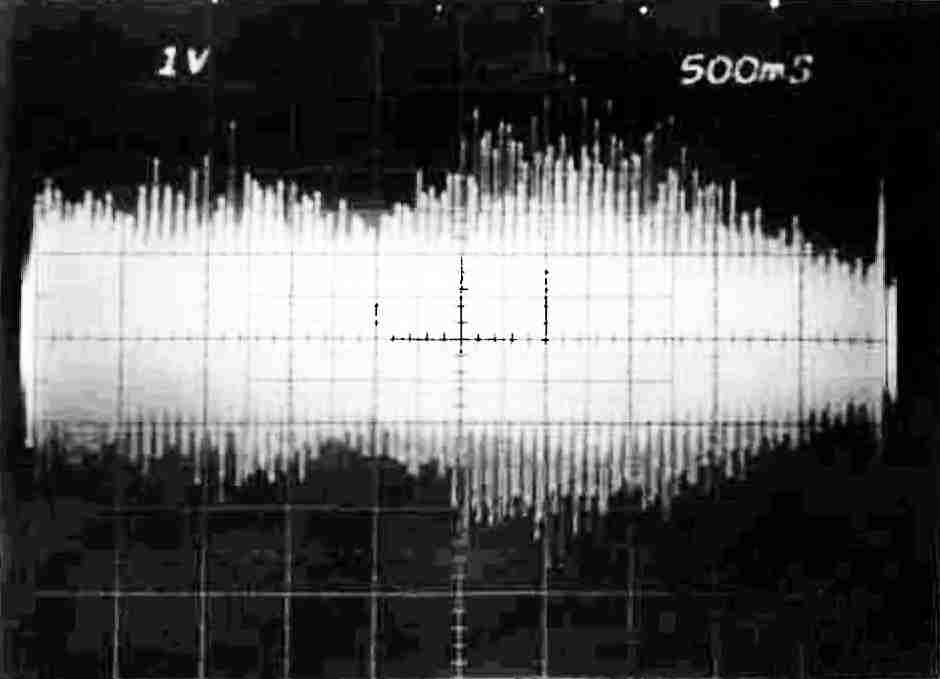
Bild 9 Oszillogramm lat. Kleinbuchstaben y
100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m
Die Schallintensität unterliegt beim Druck (gleicher Buchstaben)
Schwankungen (Bild 9). Die Ursache hierfür liegt zum Beispiel
in der Änderung der Auflagekraft des Papierniederhalters entlang
der Walze.
Buchstaben benachbarter Klassen sind deshalb nicht bzw. schwer zu
unterscheiden. Die Relationen der Schallintensität verschiedener
Druckspalten eines Buchstabens bleiben jedoch erhalten.
(Vergleiche Bild 8 und Bild 10)
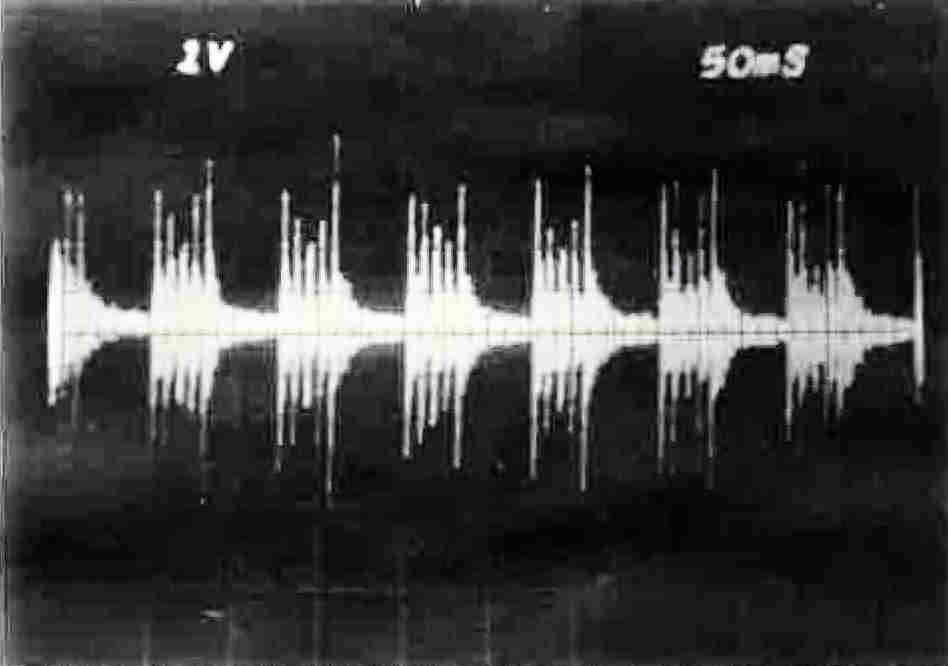
Bild 10 Oszillogramm gedruckte lat. Kleinbuchstaben w
100 Bd, mit Filter (Fi), a = 1 m
Reflexionen an Wänden, der allgemeine Geräuschpegel, die Auswerte-
entfernung u.s.w. beeinflussen stark die Anzahl unterscheidbarer
Zeichen, so daß die theoretischen Werte nach Anlage 1 nicht
erreicht werden.
3.3.3. Einfluß des Grundgeräuschpegels
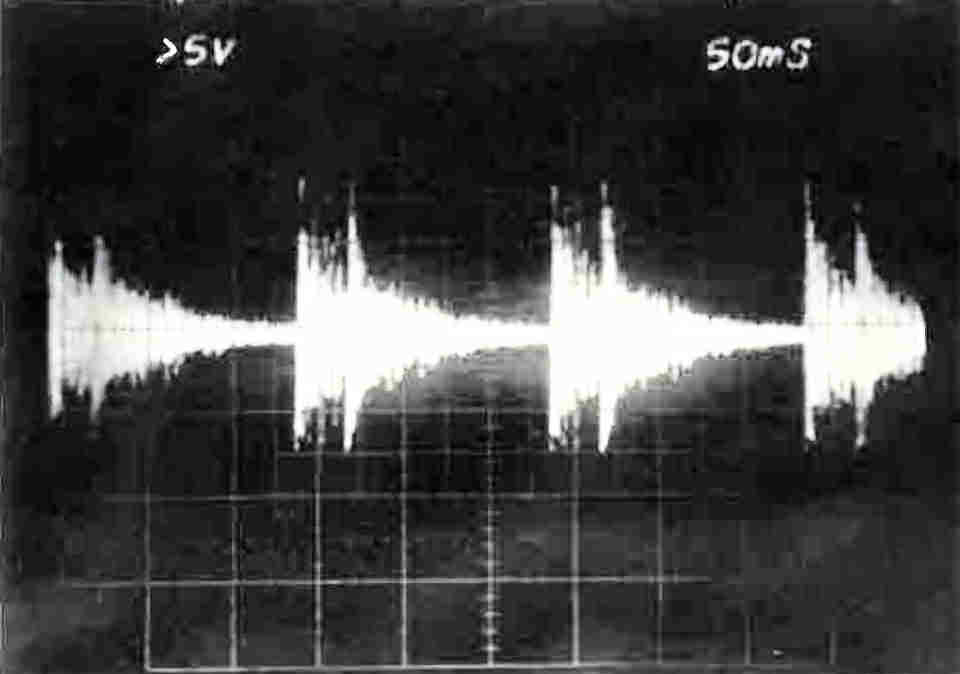
Bild 11 Oszillogramm gedruckte lat. Kleinbuchstaben u
50 Bd, a = 1 m ohne Filter
Grundgeräuschpegel ca 55 dB
Bild 11 zeigt eine Aufnahme ohne Filter (Bandpaß). Deutlich sind
Ausschwingvorgänge des Druckermagneten nach der Erregung zu er-
kennen. Ein Bandpaß bringt jedoch eine wesentliche Qualitätsver-
besserung (vergleiche Bild 6). Nach einer Erhöhung des Grundge-
räuschpegels (durch Lüfter, Ventilatoren, Unterhaltung) auf über
60 dB ist ohne Filter auch in Entfernung a = 0,2 m keine Aus-
wertung mehr möglich.
Die Aufnahmen Bild 5 bis 10 wurden bei einem Grundgeräuschpegel
von 66 dB mit einem Bandpaß (Durchlaßbereich 2,8 kHz bis 5,6 kHz)
aufgenommen. Die übrigen Geräuschquellen mit wesentlich tieferen
Frequenzanteilen wirken nicht störend.
Die typischen Frequenzanteile des Druckwerkes (ca. 2 … 6 kHz)
ermöglichen somit eine selektive Trennung von anderen akustischen
Quellen mit niedrigeren bzw. höheren Frequenzanteilen.
Bei Einschalten des Stanzers ist mit den dargestellten Methoden
keine Auswertung mehr möglich.
3.3.4. Einfluß der Meßentfernung

Bild 12 Oszillogramm gedruckte lat. Kleinbuchstaben v
100 Bd, a = 3 m, mit Filter (Fi),
Grundgeräuschpegel 66 dB
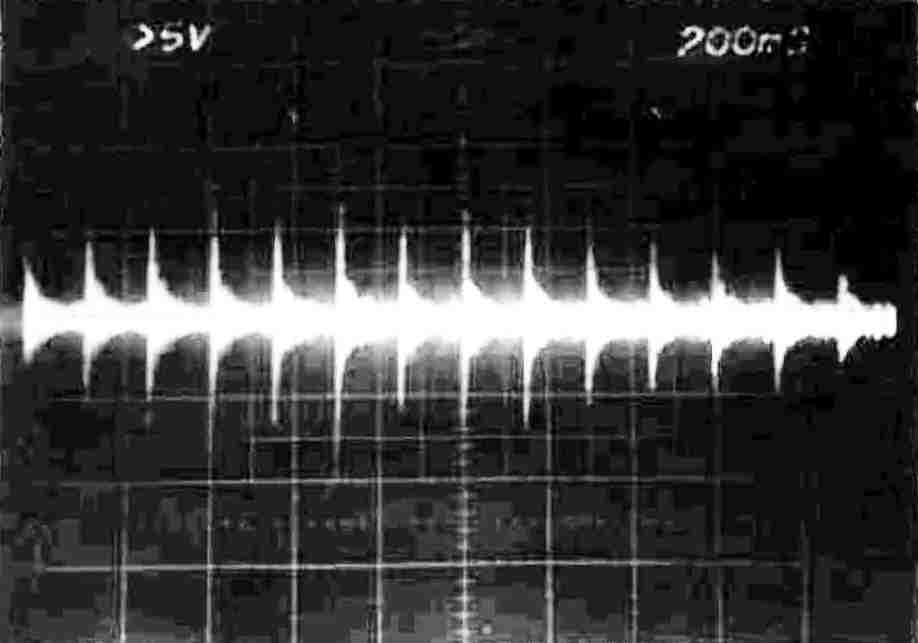
Bild 13 Oszillogramm gedrucktes Zeichen: .(Punkt)
50 Bd, a = 2 m, ohne Filter(Fi),
Grundgeräuschpegel 55 dB
Bild 12 beweist, daß in 3 m Abstand auch bei hohem Grundgeräusch-
pegel eine Auswertung solcher Buchstaben möglich ist, bei denen
wenig Druckernadeln gleichzeitig anschlagen.
Die Möglichkeit der Auswertung der akustischen Abstrahlung einer
Druckernadel durch Messung ohne Bandpaß (Fi) und bei geringem
Grundgeräuschpegel im Abstand von 2 m wird mit Bild 13 demon-
striert.
3.4. Verhinderung der kompromittierenden akustischen Abstrahlung
Da konstruktive Veränderungen am Gerät zur Verringerung der aku-
stischen Abstrahlung aus technischen und ökonomischen Gründen
kaum realisierbar sind, müssen andere Maßnahmen getroffen werden.
Die erforderliche Schalldämmung ist durch die stationären bzw.
mobilen Einrichtungen zu gewährleisten, in denen elektronische
Fernschreibgeräte betrieben werden.
Die Werte der Schalldämmung (Absorptionskoeffizient) sind unter
Berücksichtigung des Abschnitts 3.3.1. zu ermitteln, in die
"Regelungen und Bestimmungen für das Chiffrierwesen der DDR"
aufzunehmen und nach Erfordernis weiter zu präzisieren.
Pauschale Forderungen, daß von außenstehenden Personen keine
Gespräche mitgehört werden dürfen, die im Chiffrierraum geführt
werden bzw. eine kontrollierte Zone von 10 m zu schaffen ist,
genügen nicht, um das Problem akustische Abstrahlung der FSM
des Systems F 1000 zu lösen.
Sind die Maßnahmen zur Schalldämmung nicht realisierbar, sind
spezielle Hinweise zur Betriebsabwicklung insbesondere im Zu-
sammenwirken mit der Chiffriertechnik zu erarbeiten und in die
Gebrauchsanweisungen und sonstigen Vorschriften aufzunehmen.
Sie dienen dazu, eine mögliche Auswertung der akustischen Ab-
strahlung maximal zu erschweren.
4. Abstrahlung durch Stromaufnahmeänderungen
4.1. Ursachen kompromittierender Stromaufnahmeänderungen
Die Fernschreibmaschine F 1100 hat mehrere elektromechanische
Baugruppen mit kurzzeitig hohem Leistungsbedarf (Axialkupplung,
Nadelmagnete, Stanzereinheit u.s.w.). Die hohen impulsförmigen
Ströme, die während der Ansteuerphasen fließen, bewirken netz-
seitig eine bestimmte Abhängigkeit vom momentanen Leistungsver-
brauch dieser Baugruppen, aus dem Rückschlüsse über die verarbei-
teten Informationen möglich sind. Dies betrifft Nachfolgende
Baugruppen:
- Nadelmagnete
Die Nadelmagnete werden mit der Gleichspannung U3 (+18 V) betrie-
ben und im 133 Hz-Raster für jeweils 1,1 ms erregt. Ein Nadel-
magnet nimmt dabei einen Strom von mehr als 1 A auf, wobei maxi-
mal 7 Nadelmagnete gleichzeitig angesteuert werden. 2 Pufferkon-
densatoren zu je 4700 μF die sich in der Nähe der Nadelmagnete
befinden, decken den Energiebedarf in der ersten Phase ab. Der
Zuwachs der netzseitigen Stromaufnahme ist der Anzahl der jeweils
erregten Nadelmagnete proportional. Somit ist theoretisch eine
Einteilung in unterscheidbare Zeichen möglich (siehe Anlage 1)
- Axialkupplung
Die Axialkupplung wird ebenfalls mit der Gleichspannung U3 (+18 V)
betrieben. Eine Überstromsteuerung (R-C-Glied) liefert den notwen-
digen Anzugsstrom beim Betätigen des Zeilenendkontaktes. Aus dem
Zuwachs der netzseitigen Stromaufnahme ist somit der Druckwagen-
rücklauf ersichtlich.
- Lochbandstanzer
Der Lochbandstanzer als Anbaueinheit arbeitet mit einer eigenen
Stanzerlogik, die vom Taktsystem des Grundgerätes gesteuert wird.
5 Markierungsmagnete (MM) bereiten die Stanzung des jeweiligen
Zeichens vor, während ein Stanzmagnet (MS) gleichzeitig die Stan-
zung der 5 Informationsspuren und der Transportspur übernimmt.
Ca. 19 ms nach dem Stanzen erfolgt durch den Transportmagneten (MT)
der Lochstreifentransport.
Die Impulsdauer zur Ansteuerung aller Magnete beträgt jeweils 20 ms.
Der Zuwachs der netzseitigen Stromaufnahme ist damit der Anzahl
der angesteuerten Markierungsmagnete proportional. Somit ist theo-
retisch eine Einteilung der 32 möglichen Kombinationen des
ITA Nr.2 in 5 unterscheidbare Klassen möglich.
- Schrittmotore
Die Schrittmotore (Wagenschrittmotore, Walzenschrittmotor) werden
ebenfalls impulsförmig angesteuert, benötigen jedoch relativ
geringe Energien.
Eine Stromüberhöhung bei Ansteuerung des Wagenschrittmotors ohne
Ausdruck eines Zeichens bedeutet somit einen Zwischenraum.
Die Stromüberhöhung bei Ansteuerung des Walzenschrittmotors er-
folgt synchron mit der Ansteuerung der Axialkupplung, da mit ist
der Druckwagenrücklauf ersichtlich.
4.2. Auswertebeispiel der Stromaufnahmeänderung
4.2.1. Versuchsaufbau
FSM Fernschreibmaschine F 1100
Oszi Speicheroszilloskop
Adapter Versuchsschaltung zur Darstellung der Stromauf-
nahme R = 1 … 5 Ω
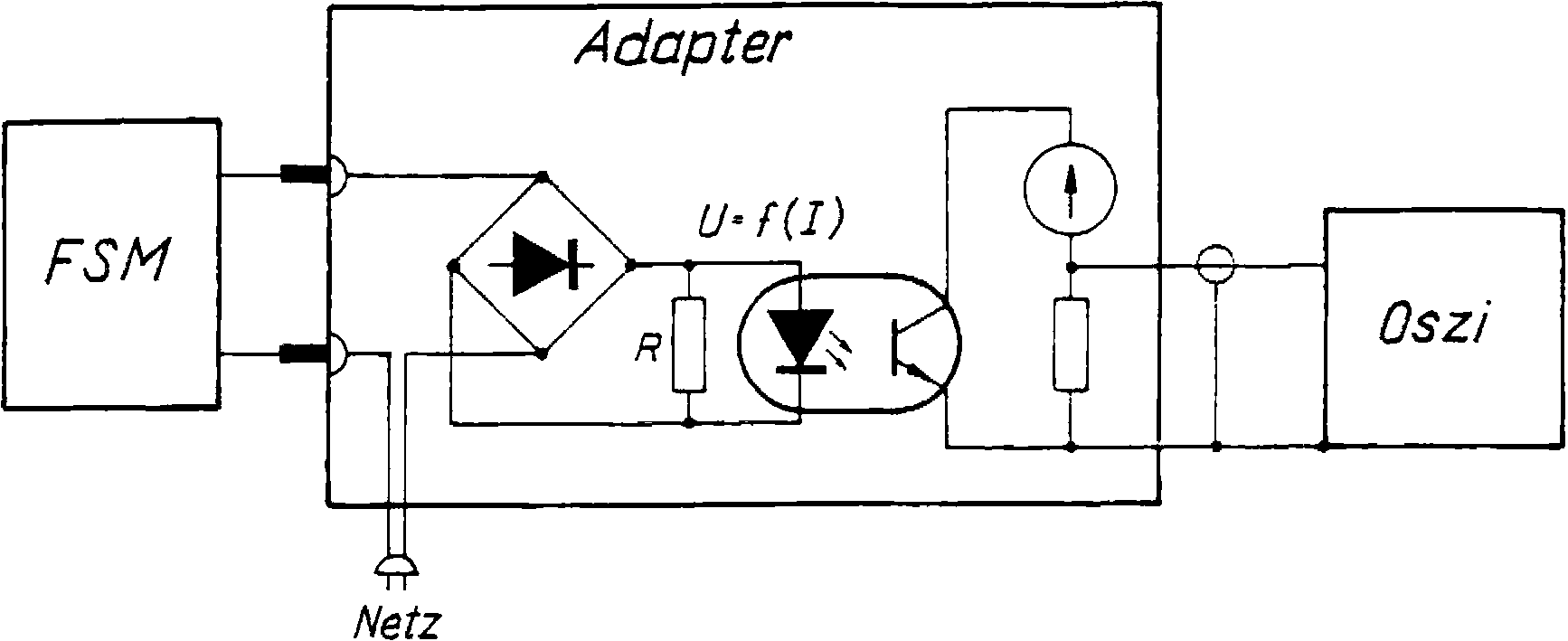
Bild 14 Nachweis der Netzstromänderungen (Prinzip) 4.2.2. Ergebnisse
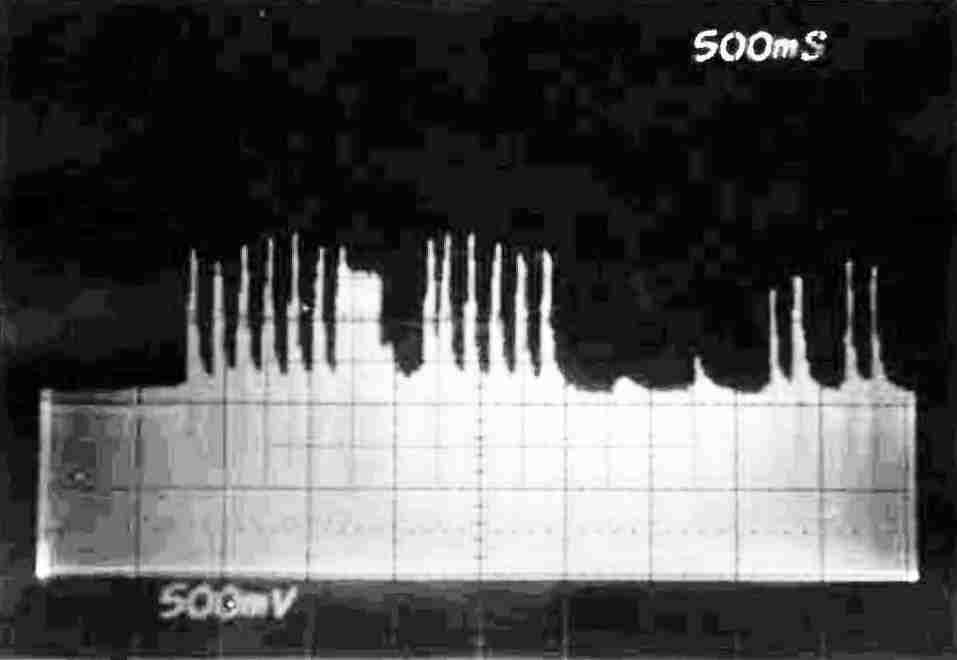
Bild 15 Oszillogramm Stromaufnahme
Tastatureingabe 50 Baud
Leser und Stanzer aus, Druckwerk ein
Dargestellt sind Eingabepause, 6 ausgedruckte Buchstaben, Druck-
wagenrücklauf, weitere 6 ausgedruckte Buchstaben, Eingabepause,
Zwischenraum, Eingabepause, Punkt, Eingabepause und weitere Zeichen.
Die Stromüberhöhung während des Druckwagenrücklaufes resultiert aus
der Überlagerung vom Stromverbrauch der Axialkupplung und des Wal-
zenschrittmotors (Vertikalschrittmotor).
Da die Wagenbewegung ohne Druck ( = Zwischenraum) eindeutig von der
Ansteuerung eines einzigen Nadelmagneten (Punkt) zu unterscheiden
ist, kann auch bei diskontinuierlicher Tastatureingabe das Schrift-
bild (Wortlänge, Anzahl gedruckter Zeichen) eindeutig ausgewertet
werden.
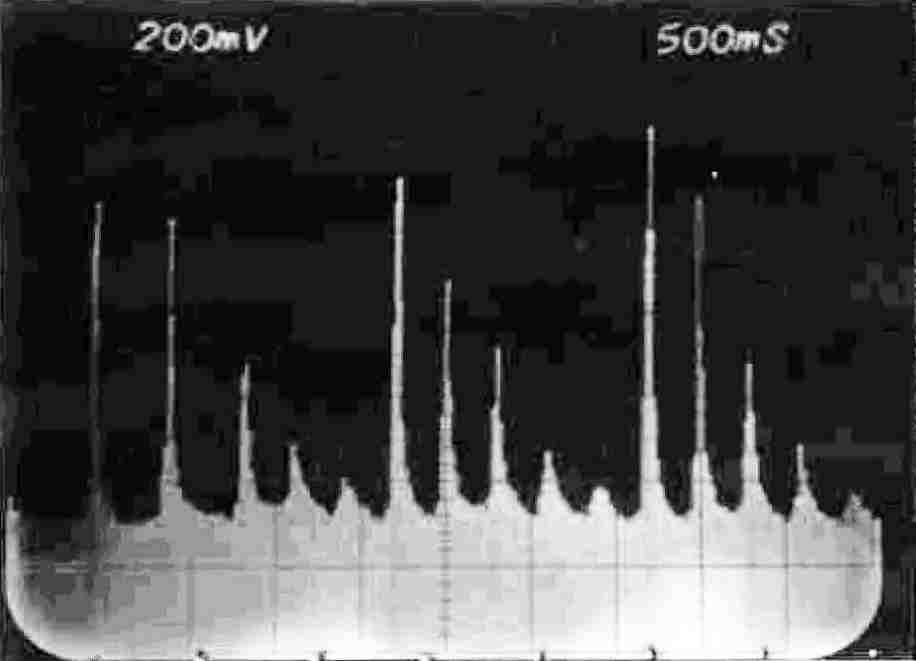
Bild 16 Oszillogramm Stromaufnahme
0+- 0+- 0+-
Tastatureingabe, 50 Baud,
Leser und Stanzer aus, Druckwerk ein
Bild 16 zeigt, daß Zeichen mit stark unterschiedlicher Anzahl an
Druckpunkten unterscheidbar sind. Die Zwischenräume sind ebenfalls
deutlich sichtbar.
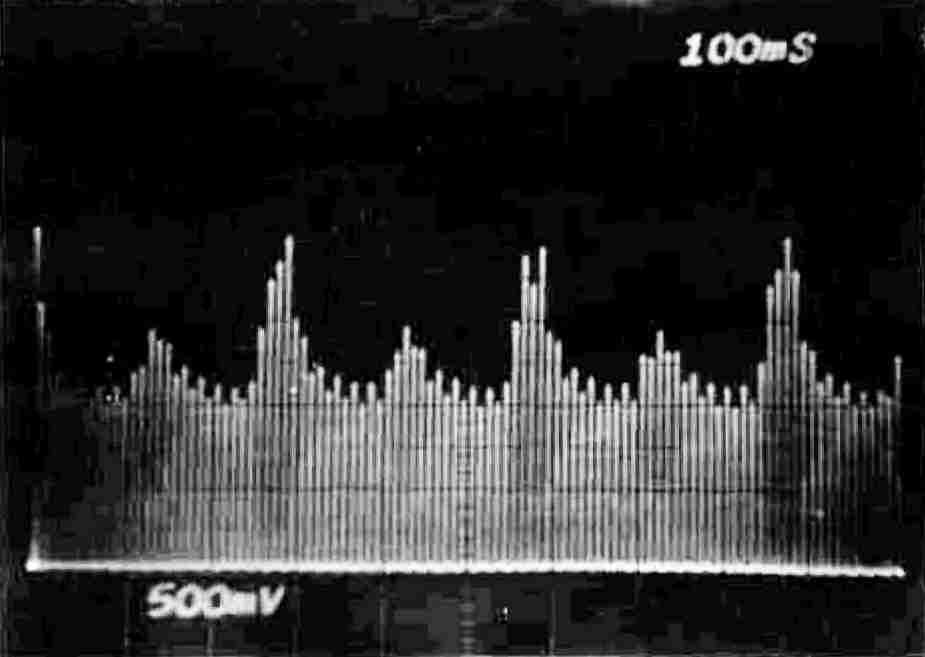
Bild 17 Oszillogramm Stromaufnahme
-0-0-0
Tastatureingabe, 50 Baud,
Leser, Stanzer aus, Druckwerk ein
Bild 17 zeigt die Zeichen Null und Minus in gedehnter Darstellung.
Hier sind von der jeweiligen Phasenlage des Wechselstromes
(100 Hz) bedingte Unterschiede sichtbar.
Die Stromaufnahme ohne Zeichenverarbeitung beträgt 1,1 A, die
Maxima für die gedruckten Zeichen 1,21 A und 1,39 A.
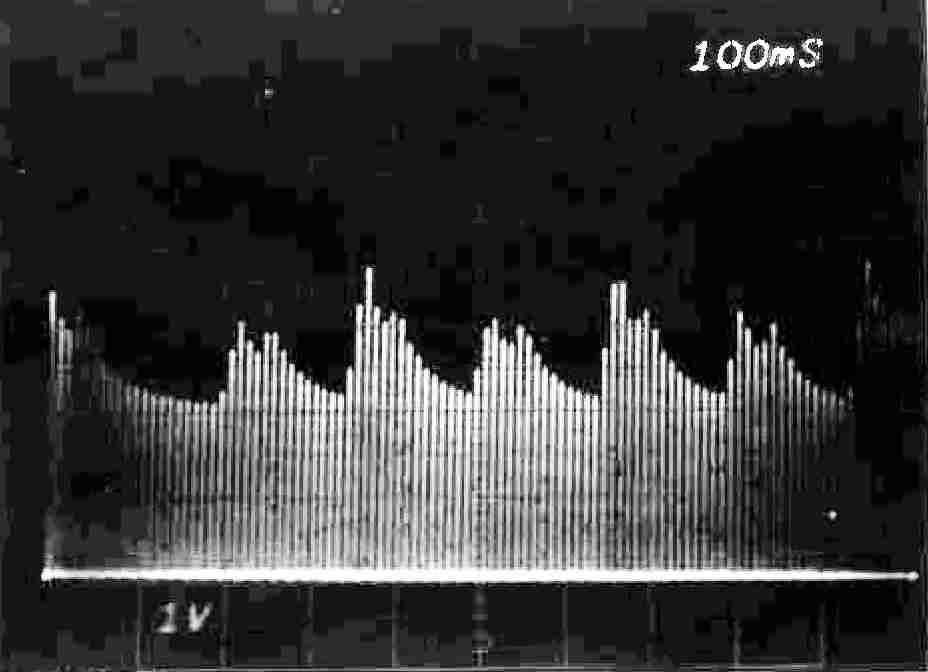
Bild 18 Oszillogramm Stromaufnahme
Tastatureingabe,50 Baud
Leser und Druckwerk aus, Stanzer ein
gestanzte Zeichen:
ITA Nr. 29(Buchstabenumschaltung)
ITA Nr. 20(T)
Bild 18 zeigt die Unterschiede der Stromaufnahme netzseitig, her-
vorgerufen durch die Markierungsmagnete (so Abschnitt 4.1),
wobei abwechselnd ein und 5 Löcher gestanzt wurden.
4.3. Auswertemöglichkeiten
4.3.1. Allgemeines
Während dem Demonstrationsversuch gewisse Mängel anhaften (z.B.
Nichtlinearität des Indikators), kann durch den Einsatz von
Schleifengalvanometern mit entsprechender Grenzfrequenz ein un-
verfälschtes Abbild der Stromaufnahme erzielt werden.
Der Einsatz weiterer Meßverfahren und -methoden (Kompensations-
meßverfahren, Korrelationsmeßverfahren usw.) eine Quantisierung,
Speicherung und anschließende rechnergestützte Auswertung läßt
bei entsprechendem Aufwand auf eine große Anzahl unterscheidba-
rer Klassen bezüglich Druckwerk schließen (siehe Anlage 1).
Die Ergebnisse aus dem Abschnitt 4.2.2. und die o. g. Möglichkeiten
zeigen, daß die Stromaufnahme des Druckwerkes ein äußerst
kritisches Moment der Abstrahlungssicherheit der FSM des Systems
F-l000 darstellt, wenn auf dieser FSM geheimzuhaltende Texte ge-
schrieben bzw. ausgegeben werden sollen.
Es wird eingeschätzt, daß die Auswertung des Stanzers im Vergleich
zu den anderen Ergebnissen praktisch ohne Bedeutung ist.
4.3.2. Einfluß weiterer Verbraucher der FSM F 1100
Sobald alle Verbraucher der FSM (Leser, Stanzer, Drucker) gleich-
zeitig in Betrieb sind, tritt eine Überlagerung in der Stromauf-
nahme ein, die die Auswertemöglichkeiten einschränkt (Reduzierung
der Klassen; siehe Bild 19).
Der Leser allein (d. h. Stanzer abgeschaltet) verfälscht die
Stromaufnahme des Druckwerkes nur geringfügig.
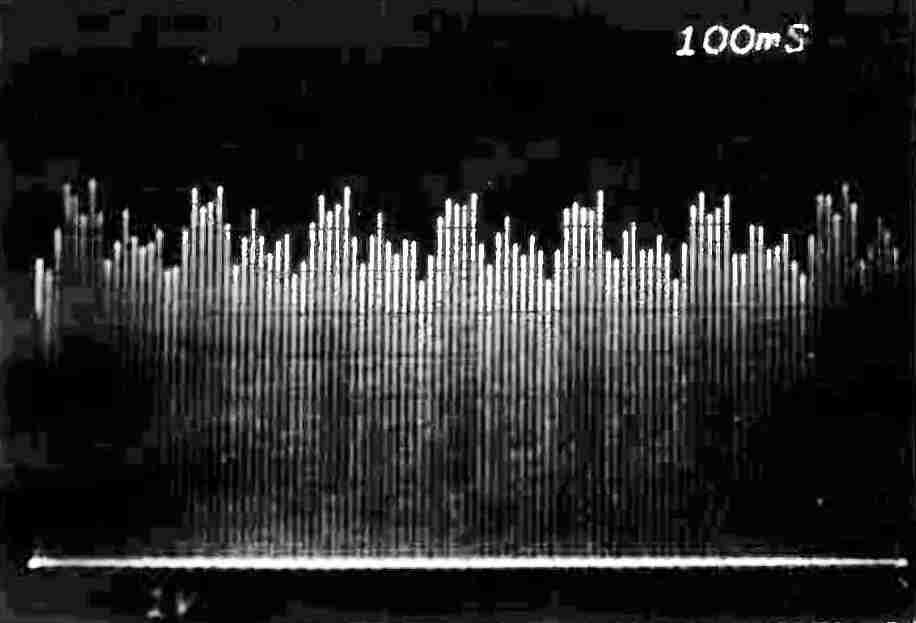
Bild 19 Oszillogramm Stromaufnahme Lesereingaben: Register 2
Zeichen Nr. 16 (0), Nr. 1 (-)
50 Bd; Druckwerk ein, Stanzer eingeschaltet
4.3.3. Einfluß der Meßentfernung und zusätzlicher Verbraucher
Zur Auswertung kann jeder Punkt der Energieversorgungsleitung von
der Netzanschlußdose der FSM bis zur Umspannstation herangezogen
werden.
Verbraucher mit zeitlich konstanter Stromaufnahme, die zwischen
FSM und Auswertepunkt liegen, beeinflussen die Auswertung nicht,
sofern ihr Leistungsverbrauch gegenüber der FSM nicht wesentlich
höher liegt.
Bei Verbrauchern mit veränderlichem, aber bekanntem Stromaufnahme-
Zeitverhalten kann durch meßtechnische Maßnahmen die Änderung
eliminiert werden.
Verbraucher mit stochastischen verteilten Leistungsänderungen
(z. B. fliehkraftgeregelte FSM-Motore T 51) können die Auswertung
ganz verhindern.
4.4. Verhinderung der kompromittierenden Stromaufnahmeänderungen
Schaltungsänderungen an der FSM, wie Erhöhung der Pufferkapazi-
täten C1, C2 des Druckwerkes, Umdimensionierung des Netzteiles
und Konstanzstromquellen werden als wirkungsvollste Maßnahmen
angesehen. Angesichts der 1981 beginnenden Serienproduktion der
FSM F 1100 sind diese Änderungen nicht mehr realisierbar.
In Objekten, die über eine eigene Umspannstation verfügen und in
denen niederspannungsseitig die gesamte Leitung bis zum Verbrau-
cheranschluß des F 1100 in die kontrollierte Zone einbezogen
werden kann, sind keine Maßnahmen erforderlich.
Treffen diese Bedingungen nicht zu, ist eine der folgenden Maß-
nahmen zu realisieren:
- Einsatz von Motorgeneratoren zur Trennung der Netze
- Gleichzeitiges Betreiben von Verbrauchern mit stochastischen
Schwankungen der Stromaufnahme
Weitere theoretische und praktische Untersuchungen mit den
Schwerpunkten
- Problem Nadelrasterdruck
- Ermittlung weiterer wirkungsvoller Gegenmaßnahmen beim Ein-
satz von Nachrichtengeräten mit ähnlichen Erscheinungen
zu der Problematik kompromittierende Stromaufnahmeänderungen
sind erforderlich.
5. Funkstörungen
5.1. Überblick
Ursachen von Funkstörungen und Funkstörquellen sind aus der Li-
teratur hinlänglich bekannt. Praktisch führen alle schnell ver-
änderlichen elektrischen Vorgänge zu Funkstörungen. Die FSM F1100
beinhaltet eine große Anzahl verschiedenster Störquellen. Hier
sollen nur einige charakteristische Störquellen, die Zur kompro-
mittierenden Abstrahlung beitragen, näher untersucht werden.
Auf alle übrigen Funkstörungen wird nur in sofern eingegangen,
als sie die Auswertung kompromittierender Störungen beeinflussen.
5.2. Messung der Funkstörungen nach TGL 20885
Die vom Fernschreiber erzeugten Funkstörungen sind in einem Meß-
protokoll -Anlage 2- zusammengefaßt. Diese Funkstörungen resul-
tieren aus der Gesamtheit aller Störquellen im Betriebszustand
Lokalbetrieb 100 Baud mit eingeschaltetem Leser, Stanzer und
Druckwerk.
Vorgeschriebene Grenzwerte nach TGL 20885/16 und Herstellerga-
rantien, die noch unterhalb dieses staatlichen Standards liegen,
werden eingehalten. Die Werte der Funkstörstrahlung liegen an
der Nachweisgrenze der Meßgeräte.
5.3. Kompromittierende Funkstörungen
5.3.1. Allgemeine Meßbedingungen
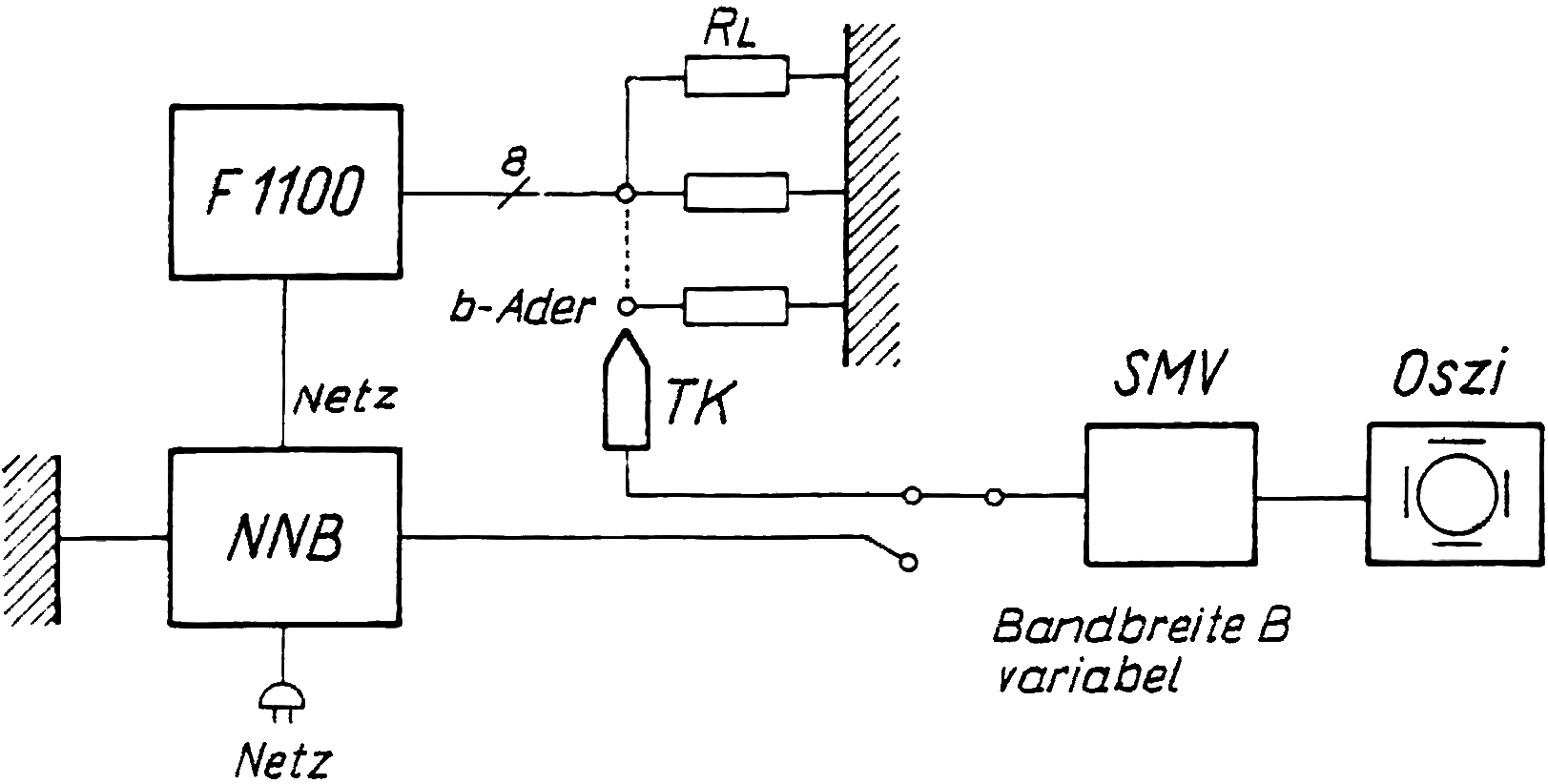
Bild 20 Meßaufbau Funkstörspannung
Soweit nicht anders vermerkt, wurde der Meßaufbau nach Bild 20
mit dem Tastkopf TK 102 zum Nachweis informationshaltiger Funk-
störspannungen benutzt.
F 1100 Fernschreibmaschine (Betriebsart Lokalbetrieb, 100 Baud)
NNB Netznachbildung NNB 101 für f ≤ 30MHz
NNB 103 für f ≤ 30MHz
SMV Selektives Mikrovoltmeter SMV 6 für f ≤ 30MHz
SMV 8.5 für f ≥ 30MHz
TK Tastkopf TK 102 bzw. TK 103
Oszi Speicheroszilloskop Tektronix
RL Lastwiderstände = 620Ω zum Abschluß der
Telegraphieanschlußleitung
5.3.2. Funkstörungen der Drucknadelmagnete und ihrer
Ansteuerschaltung
Die kritischsten Funkstörungen des Fernschreibers F 1100 werden
durch die Störimpulse hervorgerufen, die im Moment des Ansteuerns
der Nadelendstufen entstehen. Dadurch werden Informationen über
die gedruckten Zeichen abgestrahlt. Diese sind nur im Raster
von ca. 7,5 ms (entsprechend dem Drucktakt) nachweisbar.
Die Amplituden der Störimpulse sind von der Anzahl gleichzeitig
angesteuerter Drucknadelmagnete abhängig.
Die Funkstörungen sind auf der Netzanschlußleitung und an allen
Anschlüssen des Telegraphieanschlusses vorhanden. Es handelt sich
um breitbandige Funkstörspannungen im Frequenzbereich von ca.
2 bis 20 MHz. Die Amplituden betragen ca. 10 μV (Quasispitzenwert)
(Vergleiche Anlage 3 Diagramm 3, Kurve 3 und Diagramm 4, Kurve 5)
Die Bilder 21 bis 23 zeigen typische Abstände von Störimpulsen
entsprechend dem Druckraster (Vergleiche Anlage 1)
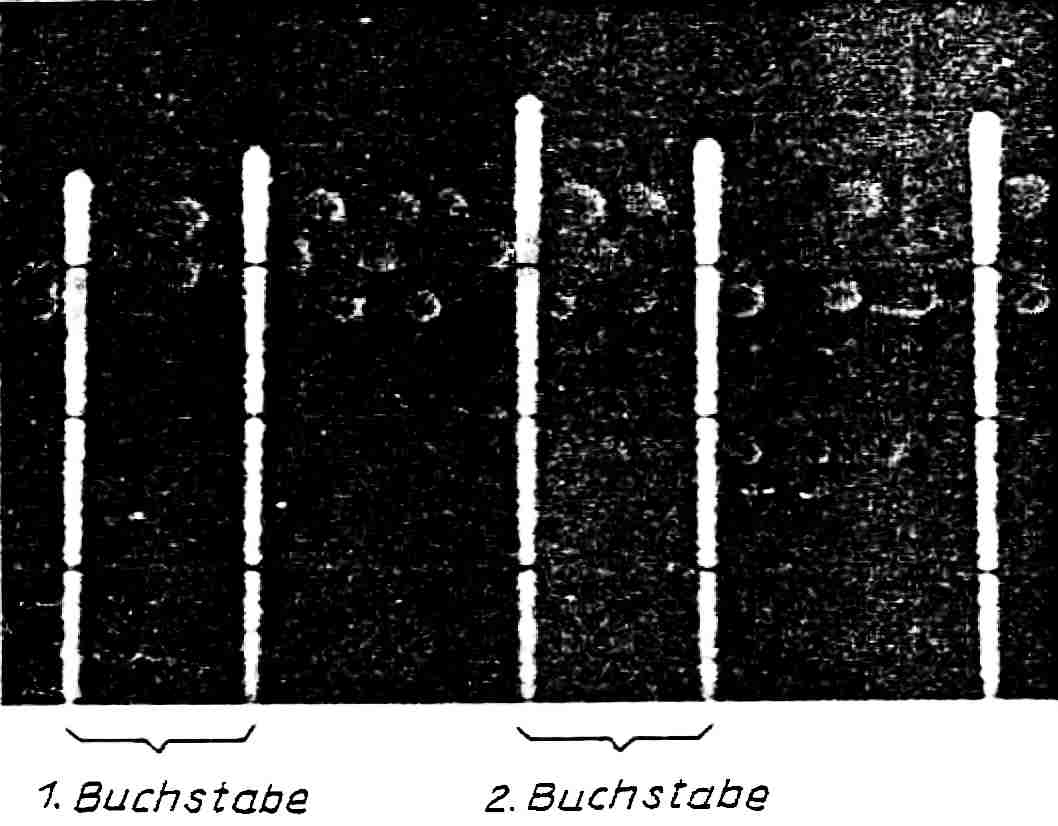
Bild 21 Oszillogramm Funkstörspannung Linie
f = 8,9 MHz, B = 9 kHz,
Zeitraster = 50 ms
lat. Kleinbuchstabe n
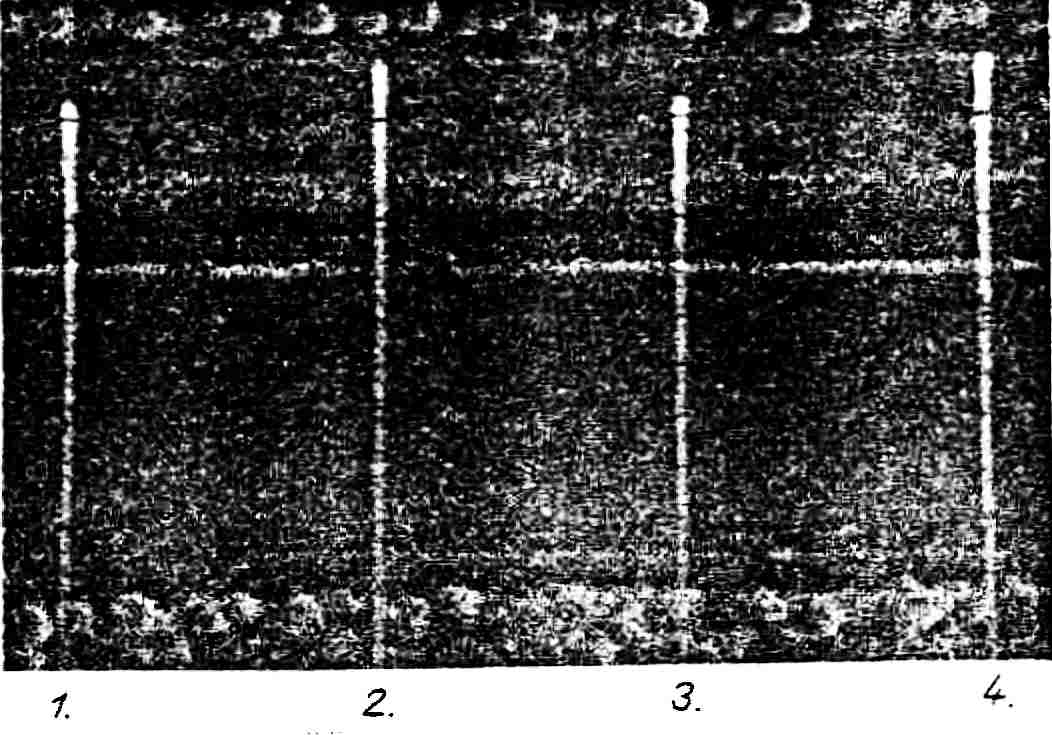
Bild 22 Oszillogramm Funkstörspannung Linie
f = 8,9 MHz , B = 9 kHz, 100 Bd
Zeitraster = 50 ms
lat. Großbuchstabe T
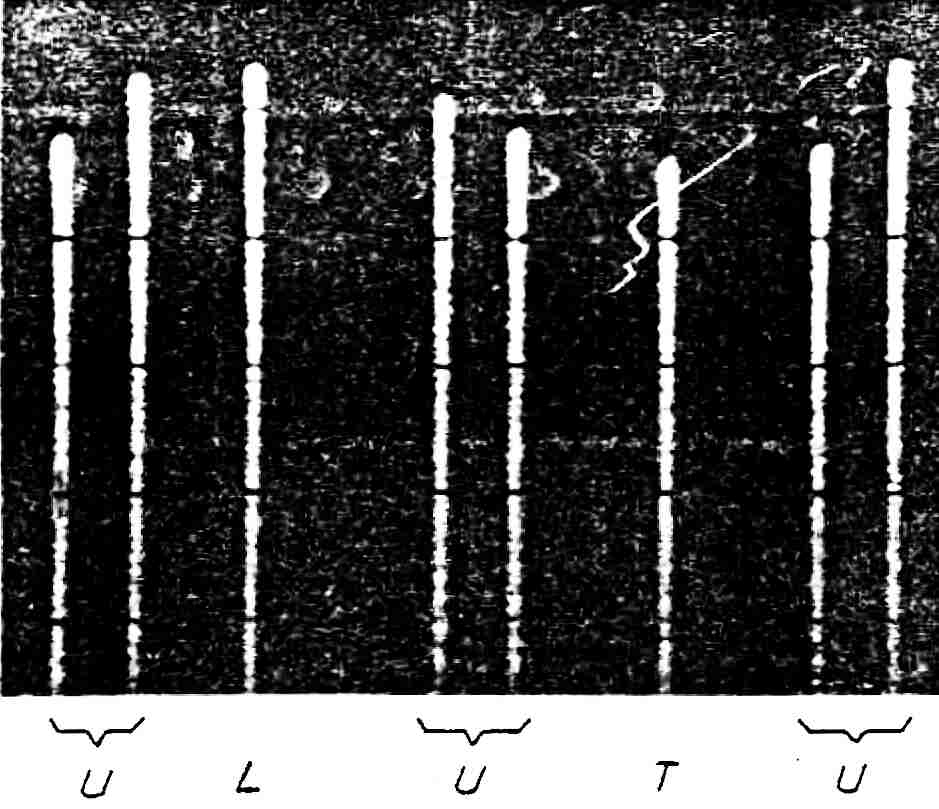
Bild 23 Oszillogramm Funkstörspannung Linie
f = 8,9 MHz, B = 9 kHz, 100 Bd
Zeitraster = 100 ms
lat. Großbuchstaben Schleife
U-L-U-T-U-L
Beim Drucken der Buchstaben L und T entstehen gleiche Störimpulse,
trotzdem sind diese Buchstaben leicht durch die Abstände zu den
vorangegangenen Störimpulsen unterscheidbar (Bild 23).
Die Amplituden der Störimpulse gleicher Zeichen sind relativ
konstant.
Bild 24 zeigt die Abhängigkeit der Amplitude von der Anzahl
gleichzeitig angesteuerter Drucknadelmagnete am Beispiel des
Buchstaben M.
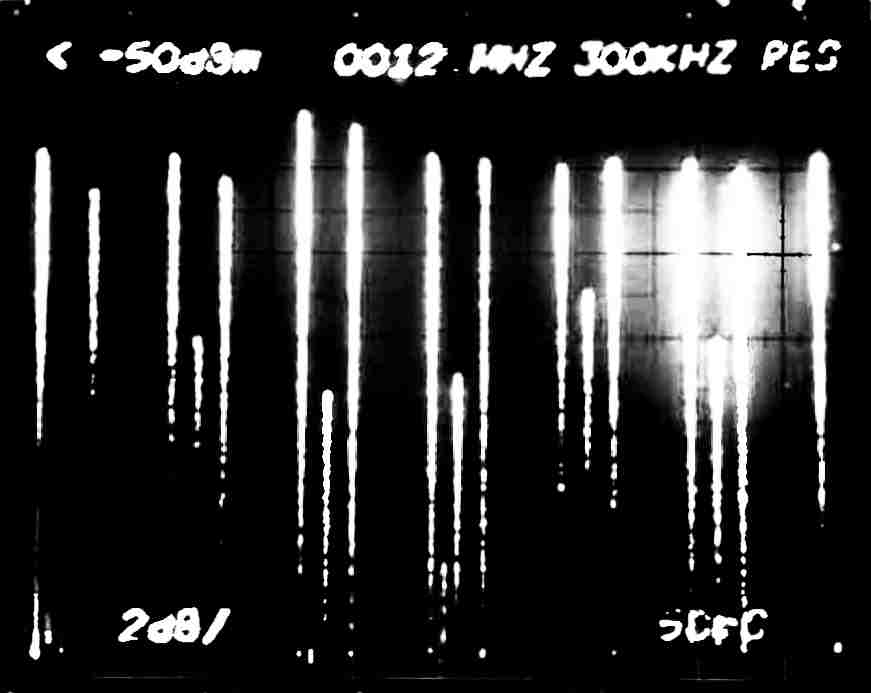
Bild 24 Oszillogramm Funkstörspannung Linie
f = 12 MHz, B = 9 kHz, 100 Bd
Buchstabe M
Ausführliche Betrachtungen zur Auswertbarkeit sind in /1/ und
/2/ zu finden.
5.3.3. Funkstörungen der Eingabetastatur und Tastaturlogik
Bei Tastatureingabe ist der Eingabezeitpunkt nachweisbar (Zeit-
punkt des Schließens der Mikrotaster). Der Störimpuls tritt Zeit-
gleich mit der Vorderflanke des Signales S1 auf. (Bild 25)
Einige Tasten (z. B. Ziffer 6 und Buchstabe u) rufen Doppelim-
pulse hervor (Vorder- und Rückflanke des Signales S1). Nach der
Größe der Störimpulse ist eine Zuordnung zu bestimmten Tasten
möglich.
Die Störimpulse sind bei Frequenzen um 30 MHz, 65 MHz und 120 MHz
auf dem Netz und auf der Linie vorhanden. Die Amplituden liegen
in der Größenordnung von 15 … 25 dBμV (Spitzenwert).
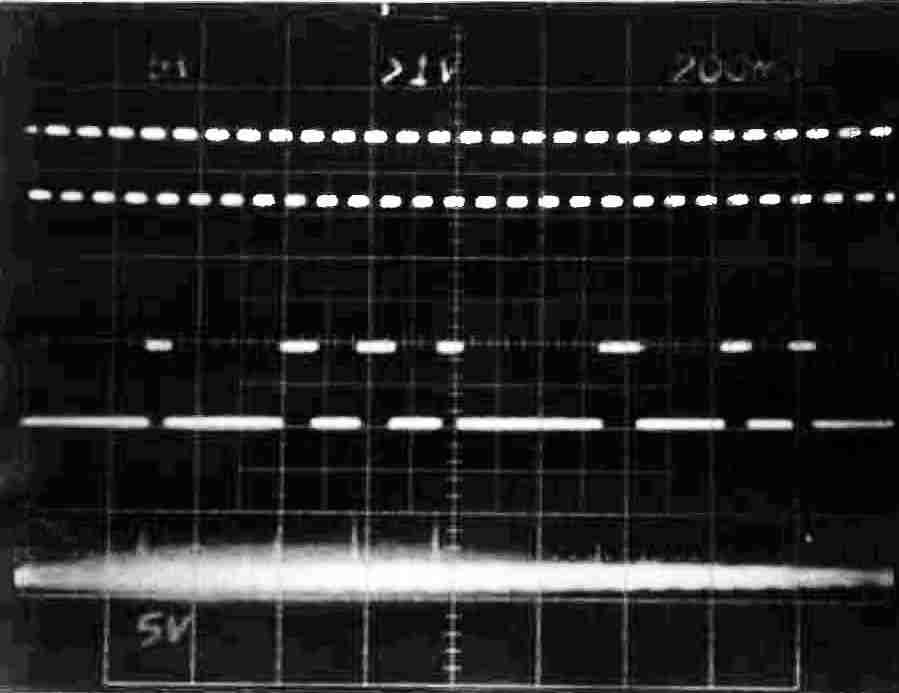
Bild 25 Oszillogramm Funkstörspannung Netz
Eingabetastatur, NNB 103, SMV 8.2,
Eingangsteiler 5 dB
Zf-Bandbreite 20 kHz
Anzeigeart AV I
Die Störimpulse verschiedener Tasten sind in ihrer Amplitude un-
terschiedlich. Die Störamplituden bei mehrmaliger Betätigung
einer Taste sind relativ konstant.
An der FSM F 1100, FaNr. 09078 ergaben sich für 2 verschiedene
Meßfrequenzen die in Tabelle 1 gezeigten Abhängigkeiten:
Tabelle 1: Relative Größen der Störimpulse, die durch die
Tastaturlogik erzeugt werden (Auswahl)
| Meßfrequenz ≈ 65 MHz | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| relative Amplitude | Tasten der Fernschreibmaschine | ||||||||||||||||||||
| klein | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | … | A | D | G | J | |||||||||||
| groß | 2 | 4 | 6 | 8 | … | S | F | H | K | … | |||||||||||
| Meßfrequenz ≈ 120 MHz | |
|---|---|
| relative Amplitude | Tasten der Fernschreibmaschine |
| klein | 1, 2, 3, …, D, E, L, R, T, … |
| ↓ | +, >, A, S, Y, N, … |
| anwachsend | 7, 8, 0, I, P, O, F, … |
| ↓ | U, H, J, Ä |
| groß | M, ? |
Die Ursachen dieser unterschiedlichen Störamplituden können schaltungsbedingt (Kodiermatrix, Tastaturlogik) oder mehr oder weniger zufällig (Verdrahtung) und somit exemplarabhängig sein. Auffällig ist die Abhängigkeit bei 65 MHz, wo jede zweite Taste gleiche Werte bringt. Durch Kombination der Meßergebnisse bei verschiedenen Frequenzen lassen sich noch mehr Klassen bilden. 5.3.4. Weitere kompromittierende Funkstörungen Weitere Funkstörquellen, wie Horizontalschrittmotor (HSM), Vertikal- schrittmotor (VSM), Markierungsmagnet (MM), Transportmagnet (MT), einige , bestimmte Taktoberwellen, die mit verschiedenen Signalen moduliert sind, haben für sich betrachtet, einen geringen Infor- mationsgehalt, können aber in Verbindung mit anderen Informationen (z. B. nach Punkt 4.2.) eine Auswertung begünstigen. (Siehe /2/) Wegen einer geschlossenen Darstellung erfolgt die Behandlung dieser Störungen unter Punkt 5.4. 5.4. Funkstörungen ohne Informationsgehalt 5.4.1. Funkstörungen der Netzteile Die Netzteile Grundgerät und Lochbandgerät erzeugen im unteren Frequenzband breitbandige Störungen hoher Amplituden, die ober- halb von 1 MHz auf Netz und Linie nicht mehr nachweisbar sind.
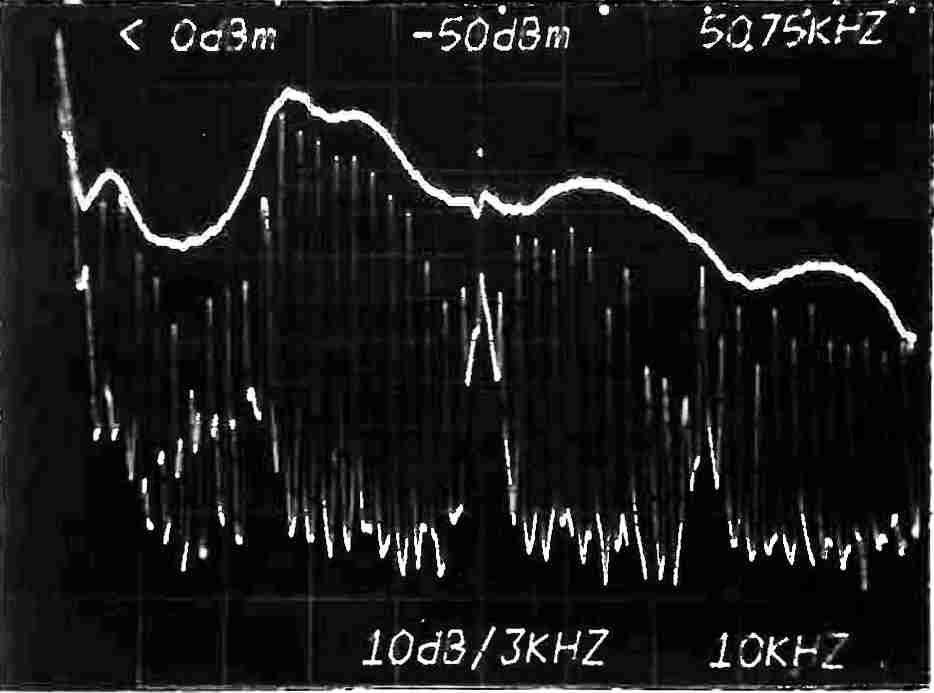
Bild 26 Hüllkurve der Funkstörspannung auf Linie
0 … 100 kHz
In Anlage 3 Diagramm 1 Kurve 3
Diagramm 3 Kurve 1
Diagramm 4 Kurve 1
sind weitere Netzteilstörungen dargestellt.
5.4.2. Funkstörungen durch Taktoberwellen
Im Fernschreiber F 1100 werden aus einer Quarzfrequenz 307,2 kHz
Grundtakte T1 und T2 von 12,8 kHz (für 50 Baud) bzw. 25,6 kHz
(für 100 Baud) hergeleitet.
Im Frequenzbereich von 12,8 kHz bis ca. 130 MHz sind Funkstörun-
gen auf diskreten Frequenzen im Abstand der Grundtakte nachweis-
bar. Nach höheren Frequenzen hin zeigen auf Linie und Netz prak-
tisch nur noch Vielfache von 102,4 kHz (entspricht der vierfa-
chen Grundfrequenz bei 100 Baud) hohe Werte.
Die Maximalwerte liegen über 100 μV.
(Anlage 3 Diagramm 1 Kurven 1 und 2
Diagramm 2 Kurven 1 und 2
Diagramm 4 Kurven 1 und 2
Diagramm 5 Kurven 1 und 2)
Im Bild 26 sind deutlich der Grundtakt T1 mit 25,6 kHz, die
1. Oberwelle mit 51,2 kHz und die 2. Oberwelle mit 102,4 kHz aus
den Netzteilstörungen zu erkennen.
Einige Taktoberwellen sind mit Informationen (Verarbeitungstakte)
moduliert. (siehe Punkt 5.3.4.) Diese Modulation ist nur bei be-
stimmten Frequenzen bzw. engen Frequenzbändern vorhanden.
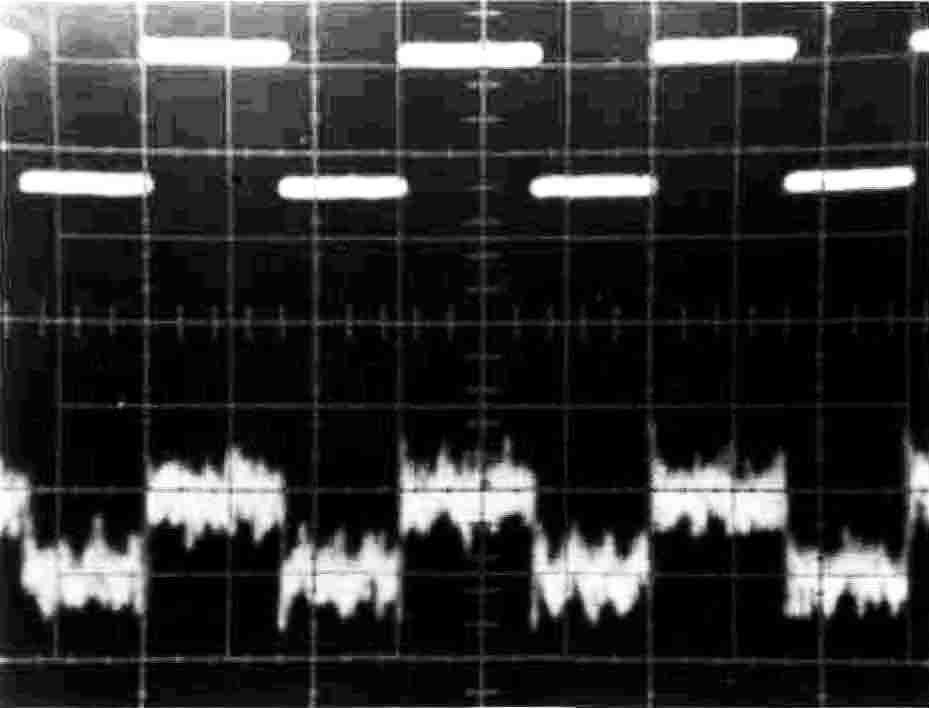
Bild 27 Störspannung Netz
f = 60 MHz, 20 dB-Grunddämpfung,
b = l kHz, Modulation vom Takt
200 mV/Teilstrich 50 ms/Teilstrich
Auf Bild 27 ist eine mit der Taktfrequenz T1 modulierte Oberwelle
dargestellt (zum Vergleich ist oben T1 dargestellt).
Auf der Frequenz 12,6 MHz sind z. 8. Markierungs- und Transport-
zeitpunkte des Stanzers sichtbar (ohne Bild).
Es wurden modulierte Taktoberwellen um 12 MHz, 30 MHz und 60 MHz
gefunden, weitere können noch existieren.
5.4.3. Funkstörungen durch Schrittmotore
Der Horizontalschrittmotor realisiert den Druckwagenvorschub durch
jeweils 8 Motorschritte je Druckzeichen (3 Leerschritte, 5 Druck-
schritte). Beim Ansteuern der Horizontalendstufen entstehen
somit 8 Störimpulse im Abstand von ca. 7,5 ms (Bild 28). Sie
sind im Frequenzbereich von 100 kHz bis max. 30 MHz nachweisbar.
Der Quasispitzenwert beträgt bis zu 50 μV. (Vergleiche Anlage 3
Diagramm 3, Kurve 3)
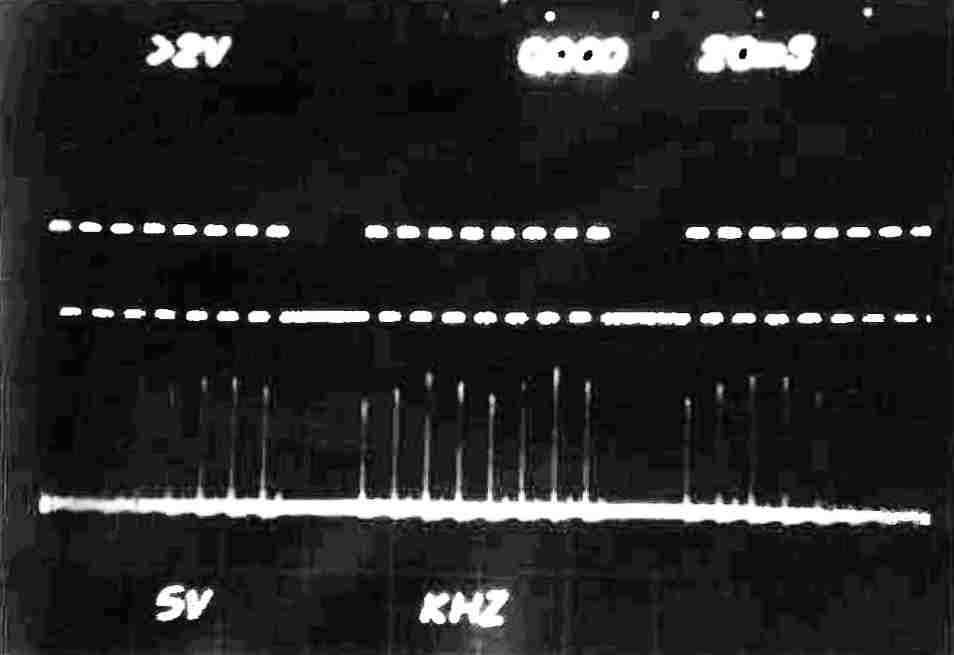
Bild 28. Oszillogramm Funkstörspannung Linie.
f = 6,9 MHz, B = 9 kHz,
Grunddämpfung = 10 dB
Horizontalschrittmotor (HSM)
oben: Ansteuerimpulse HSM
unten: Störspannung
Der Vertikalschrittmotor realisiert den Walzenvorschub (Papier-
transport). Entsprechend dem gewählten Zeilenabstand bilden 8,
12 bzw. 16 Motorschritte im Zeittakt der Druckfrequenz (133 Hz)
einen Zeilenvorschub.
Es entstehen 8, 12 bzw. 16 Störimpulse im Abstand von ca. 7,5 ms.
Sie sind im Frequenzbereich 100 kHz bis ca. 30 MHz nachweisbar.
Der Quasispitzenwert übersteigt 100 μV.
Der Leserschrittmotor erzeugt nur unbedeutende Störungen.
5.4.4. Funkstörungen des Lochbandstanzers
Bei der Ansteuerung der Markierungs- und Transportmagneten des
Lochbandgerätes entstehen ebenfalls Störimpulse, die im Frequenz-
bereich 100 kHz bis max. 25 MHz nachweisbar sind.
Der Quasispitzenwert beträgt auf dem Netzanschluß bis zu 100 μV.
(Anlage 3 Diagramm 4, Kurve 3)
Bild 29 zeigt die Störimpulse des Transport- und Markierungs-
magneten. Oben sind die Ansteuerimpulse des Markierungsmagneten
(MM) dargestellt.
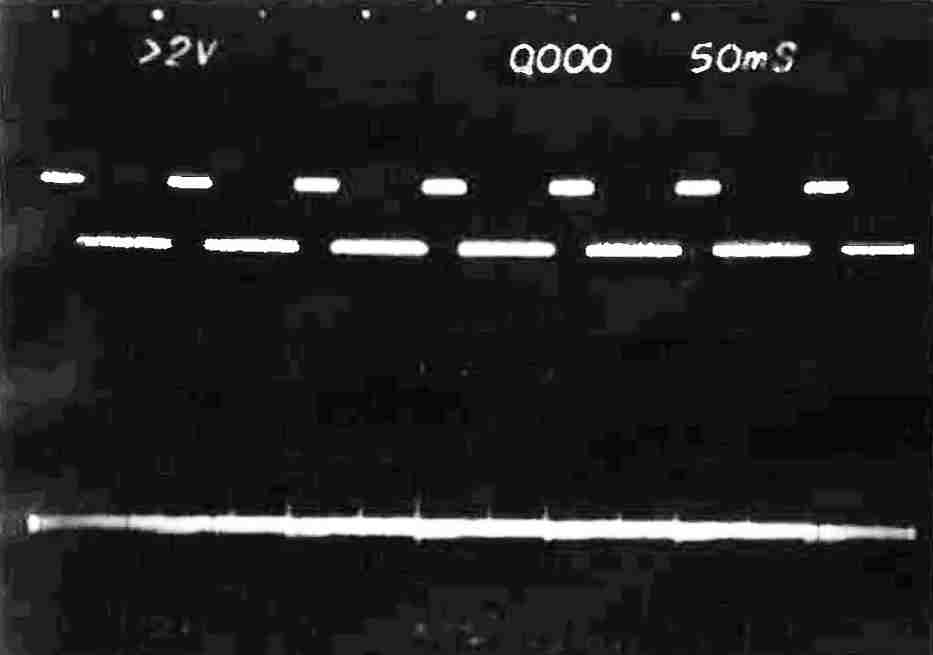
Bild 29 Oszillogramm Funkstörspannung Linie.
f = 6,7 MHz, B = 9 kHz,
Grunddämpfung 10 dB
Lochbandgerät
oben: Ansteuerimpulse MM
unten: Störspannung
5.5. Möglichkeiten der Selektion kompromittierender Funk-
störungen am F 1000
5.5.1. Allgemeines
Neben dem Informationsgehalt stellen einige konkrete physika-
lische Merkmale der kompromittierenden Funkstörungen wichtige
Kriterien dar, die es gestatten, sie von anderen Funkstörungen
zu unterscheiden.
Am Empfangsort ist stets ein Signalgemisch der Funkstörungen
nach Pkt. 5.3. und Pkt. 5.4. und systemfremder Funkstörungen
(allgemeines Störklima am Aufstellungsort mit Netzstörungen,
atmosphärischen Störungen usw., Funkstörungen weiterer Geräte
des Gerätesystems, wie z.B. Chiffriergeräte, Fehlerkorrektur-
geräte, Vermittlungseinrichtung usw.) vorhanden.
Hier sollen einige Möglichkeiten gezeigt werden, an äußeren
Meßpunkten der FSM F 1000 die kompromittierenden Funkstörun-
gen nach Pkt. 5.3. von systeminternen Funkstörungen nach
Pkt. 5.4. zu unterscheiden. Das allgemeine Störklima am
Aufstellungsort wird hierbei nicht betrachtet.
Weitere Möglichkeiten die sich aus der Anwendung spezieller
Meßtechnik und Meßmethoden (z. B. Korrelationsmeßverfahren)
sowie aus den konkreten Betriebsbedingungen ergeben können,
sind nicht Gegenstand dieser Untersuchungen. In /2/ sind ei-
nige dieser Probleme genannt.
5.5.2. Amplituden - Frequenzverlauf der Funkstörungen als
Selektionskriterium
Die an äußeren Meßpunkten der FSM nachweisbaren Funkstörungen
erstrecken sich über einen Frequenzbereich von 10 kHz bis
130 MHz. Die Hüllkurven dieser Funkstörungen sind in Anlage 2
enthalten. Die einzelnen Störquellen liefern dazu frequenz-
abhängig unterschiedliche Anteile (Anlage 3).
Die Auswertung kompromittierender Funkstörungen ist immer dann
unproblematisch, wenn keine weiteren Störer existieren (z. B.
ausgeschaltete Lochbandeinheit) bzw. wenn die sonstigen Störer
um mindestens 6 dB niedriger sind.
Solche Frequenzbereiche existieren z. B. um 0,5 MHz und 12 MHz
für Funkstörungen nach Pkt. 5.3.3. (Anlage 3 Diagramm 3 -
schraffierte Bereiche) und um 65 MHz und 120 MHz für Funk-
störungen nach Pkt. 5.3.3.
Charakteristisch für die FSM F 1000 ist die Amplitudenab-
hängigkeit einiger Funkstörungen von der Impedanz. So zeigen
sich in bestimmten Belastungsfällen sowohl auf Netz, als auch
auf Linie ausgeprägte Maxima und Minima (Anlage 3,
Diagramm 1, Kurve 3 - Minimum bei 12 MHz
Diagramm 2, Kurve 1 - rel. Maximum bei 12 MHz
Diagramm 4, Kurve 4 - rel. Minima bei 6,5 MHz, 12 MHz, 19 MHz)
Da andere Funkstöranteile diese Abhängigkeit nicht zeigen, erge-
ben sich günstige Frequenzbereiche zur Auswertung der Funkstö-
rungen der Nadelmagnete (Anlage 3, Diagramm 4 - schraffierte
Bereiche). Die Bilder 21 bis 24 sind z. B. bei solchen günstigen
Frequenzen aufgenommen worden.
5.5.3. Energieverteilung der Funkstörungen als
Selektionskriterium
Die Funkstörungen der FSM F 1000 lassen sich in zwei
Kategorien einteilen:
- Funkstörungen mit breitbandigem Spektrum
Die Störenergie ist in Abhängigkeit von der Impulsform
über einen größeren Frequenzbereich verteilt. Der Meß-
empfänger greift davon entsprechend seiner Bandbreite
einen Teil davon heraus.
Hierunter zählen: Funkstörungen der Druckermagnete
(Pkt. 5.3.2.),
Funkstörungen der Schrittmotoren
(Pkt. 5.4.3.),
Funkstörungen des Lochbandstanzers
(Pkt. 5.4.4.) und
Funkstörungen der Netzteile
(Pkt. 5.4.1.)
- schmalbandige Funkstörungen auf diskreten Frequenzen
Die Störenergie ist nur auf diskrete Frequenzen (z. B.
Oberwellen der entsprechenden Grundtakte T1) beschränkt.
Hierunter zählen: Funkstörungen der Eingabetastatur
(Pkt. 5.3.3.) und
Funkstörungen der Taktoberwellen
(Pkt. 5.4.2.)
Unabhängig von der Meßbandbreite wird die gesamte Stör-
energie erfaßt. Durch richtige Wahl von Bandbreite und
Meßfrequenz des Meßempfängers lassen sich damit der er-
forderliche Nutz-Stör-Abstand zur Unterscheidung der
kompromittierenden Funkstörung von den übrigen erreichen.
Die Funkstörungen .der Eingabetastatur (Pkt. 5.3.3.) können
z.B. bei einer Bandbreite von 0,2 kHz auf diskreten Fre-
quenzen um 30 MHz nachgewiesen werden.
Obwohl die Funkstöramplituden der Schrittmotore und des
Lochbandstanzers in diesem Frequenzbereich größer als die
der Eingabetastatur sind, nimmt der Meßempfänger aufgrund
dieser kleinen Meßbandbreite nur einen kleinen Energiean-
teil von diesen Störern auf.
Die Funkstörungen mit breitbandigen Spektren sind bis auf
die genannten Ausnahmen (Pkt. 5.5.2.) kleiner als die schmal-
bandigen Spektren (bezogen auf eine Meßbandbreite B ≤ 9 kHz).
Somit lassen sich z. B. Funkstörungen der Druckermagnete nur
zwischen den Taktoberwellen (Pkt. 5.4.2.) nachweisen, wobei
die Bandbreite kleiner als der Oberwellenabstand zu wählen
ist.
5.5.4. Zeitliche Zuordnung von Funkstörimpulsen als
Selektionskriterium
Die breitbandigen Funkstörungen der Druckermagnete, der Schritt-
motoren und des Lochbandstanzers können aufgrund der festen
zeitlichen Zuordnung zueinander unterschieden werden. Wie be-
reits in 5.3. beschrieben, sind die Funkstörungen nur zu ge-
wissen Zeitpunkten vorhanden (Zu- und Abschaltphasen bestimm-
ter Baugruppen) und haben eine relativ kurze Dauer (« 1 ms).
Dem Taktregime des F 1100 entsprechend treten damit o. g. Funk-
störungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf und können damit
lokalisiert werden.
Beispiel: Störimpulse. des HSM und der Druckermagnete n
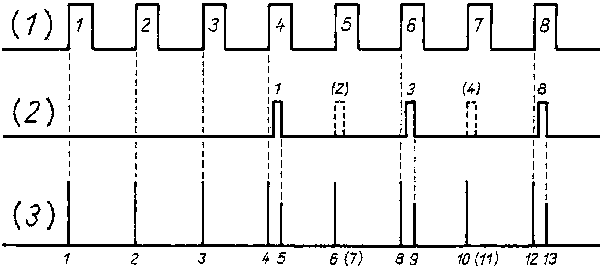
Bild 30 Impulsdiagramm HSM - n
(1) Ansteuerimpulse des Horizontalschrittmotors (HSM)
(2) Ansteuerimpulse des Druckermagneten n4
(Magnet n4 = 4. Druckerspalte, dargestelltes Zeichen: M)
(3) empfangene Störimpulse
Die Abstände der Störimpulse sind in Tabelle 2 angegeben:
| Störimpuls Nr. | Abstand (m) | Störquelle | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | HSM | Leerschritte |
| 2 | 7,52 | HSM | Leerschritte |
| 3 | 15,0 | HSM | Leerschritte |
| 4 | 22,6 | HSM | 1. Druckschritt |
| 5 | 24,5 | n | 1. Druckspalte |
| 6 | 30,1 | HSM | 2. Druckschritt |
| 7 | 32,0 | n | 2. Druckspalte |
| 8 | 37,6 | HSM | 3. Druckschritt |
| 9 | 39,5 | n | 3. Druckspalte |
| 10 | 45,1 | HSM | 4. Druckschritt |
| 11 | 47,0 | n | 4. Druckspalte |
| 12 | 52,6 | HSM | 5. Druckschritt |
| 13 | 54,5 | n | 5. Druckspalte |
| Tabelle 2 Störimpulse der Druckmagnete im Zeitregime des F 1000 | |||
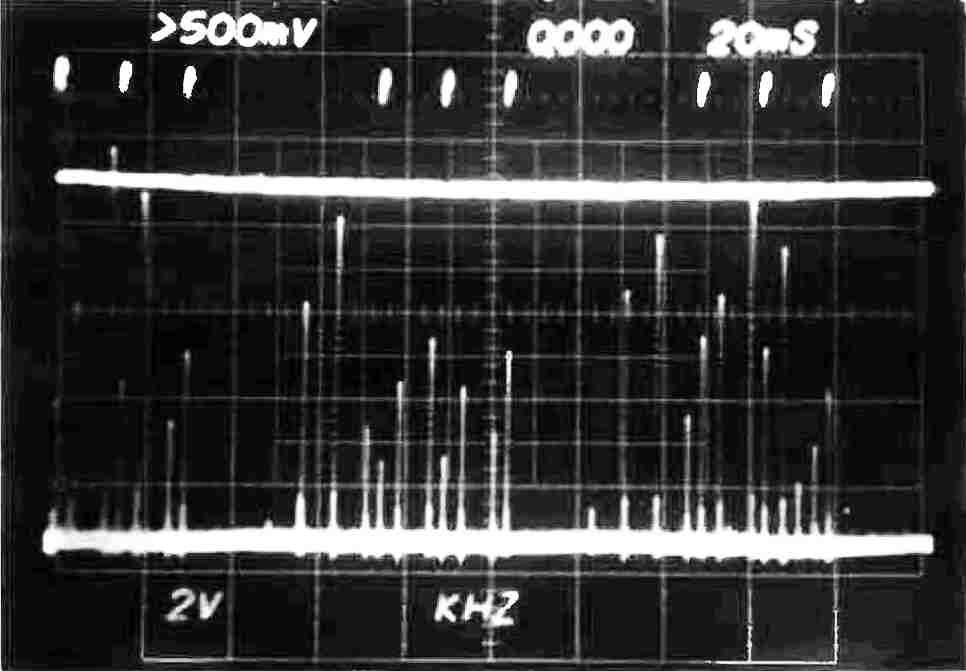
Bild 31 Oszillogramm Funkstörspannung Linie
f = 8,6 MHz, b = 9 kHz
Grunddämpfung 10 dB
oben: Ansteuerimpulse n4 für lat. Großbuchstaben M
unten: Störimpulse
Für die Funkstörungen des Lochbandstanzers gelten analoge
Beziehungen.
5.6. Ausbreitungsmöglichkeiten der Funkstörungen
5.6.1. Funkstörspannungen auf Netz
Die Ausbreitungsmöglichkeiten hängen stark vom Netzaufbau
(Installation) und der Netzimpedanz am Aufstellungsort ab
und waren nicht Gegenstand dieser Untersuchungen.
Im Gegensatz zu Messungen nach TGL 20885 können reale Netze
eine wesentlich höhere Impedanz als 150 A aufweisen. Die ab-
gegebene Störspannung ist dann größer als die in Anlage 2 er-
mittelte.
Die unkontrollierte Ausbreitung und die damit verbundene Aus-
wertemöglichkeit sind im gesamten Frequenzbereich gegeben.
5.6.2. Funkstörspannungen auf der Telegrafieanschlußleitung
Die Ausbreitungsmöglichkeiten hängen stark von der Impedanz
der Anschlußleitung, von den HF-Eigenschaften zwischengeschal-
teter Geräte (Chiffriergeräte, Doppelstromumsetzer usw.) und
den Aufstellungsvarianten ab und sind, nur an kompletten
Endstellen zu analysieren.
Den Einfluß unterschiedlicher Belastungsfälle zeigt Anlage 3,
Diagramm 1 Kurven 1 und 2 und Diagramm 2 Kurven 1 und 2. Die
Verringerung der Belastung von ca. 120Ω (620Ω || 150Ω) auf
ca. 500Ω (620Ω || 2,5kΩ) bringt den doppelten Spannungs-
gewinn (6 d8).
Die unkontrollierte Ausbreitung entlang der Fernschreiban-
schlußleitung ist sowohl im Lokalbetrieb des Fernschreibers,
als auch im Chiffrierbetrieb gegeben.
Untersuchungen zu dieser Problematik wurden noch nicht durch-
geführt.
5.6.3. Funkstörspannungen auf den Anschlußleitungen zum
Fehlerkorrekturgerät (FKG)
Der Anschluß des Fehlerkorrekturgerätes erfolgt über den
8-poligen Telegrafiestecker (Anschlüsse 5 bis 8) gemeinsam
mit dem Telegrafieanschluß (Anschlüsse 1 bis 4).
Die Anschlüsse 5 bis 8 sind weder galvanisch noch HF-mäßig
von der Logik F 1100 getrennt und führen hohe Störspannungen
(analog Pkt. 5.6.2.).
Die unkontrollierte Ausbreitung über das FKG zum Netzanschluß,
zur Fernschreibanschlußleitung und als Sekundärstrahlung ist
nicht auszuschließen. Messungen mit Anschluß eines FKG wurden
bisher nicht durchgeführt.
5.6.4. Funkstörstrahlung
Die Funkstörfeldstärke ist in 1 m Abstand von der FSM F 1100
sehr gering (Anlage 2, Diagramm 2). Sofern nicht durch sekun-
däre-Strahler (FKG, Chiffriergerät, Linienkabel, Netzkabel usw.)
ungünstigere Bedingungen geschaffen werden, würde der Fern-
schreiber in den Betriebsarten ohne Tastatureingabe den Be-
dingungen des Chiffrierwesens genügen. Bei Tastatureingabe
steigt jedoch die Funkstörfeldstärke infolge der Handkapazi-
täten und der Antennenwirkung der Bedienkraft stark an.
Konkrete Angaben zu der dabei maximal auftretenden Funkstör-
feldstärke können z Z. nicht gemacht werden, da zu viele
äußere Einflußfaktoren eine Rolle spielen. Ein Anstieg der
Feldstärke über das 10fache der Werte nach Anlage 2, Diagramm 2
wurde bei bestimmten Frequenzen bereits nachgewiesen.
Damit ist die unkontrollierte Ausbreitung besonders im Frequenz-
bereich größer 10 MHz gegeben.
5.7. Funkentstörmaßnahmen
5.7.1. Zielstellung
Wie die Messungen beweisen, ist die FSM F 1100 hochfrequenz-
mäßig ungünstig aufgebaut. Funkstörspannungen und -feldstärken
sind von den angeschlossenen Geräten (Chiffriergeräte, Fehler-
korrekturgeräte), Netzen (Telex, Handvermittlung, Standleitung,
Stromversorgungsnetzen) sowie von der Bedienung (Handkapazi-
täten bei Tastatureingabe) und den örtlichen Bedingungen ab-
hängig. Die Telegrafieanschlußleitung ist nicht gefiltert.
Eine Entstörung an der Fernschreibmaschine F 1100 ist Voraus-
setzung für eine wirksame Gesamtentstörung.
Es wurden solche Möglichkeiten zur Funkentstörung der Fern-
schreibmaschine erprobt, die gegenwärtigen Entwicklungs-
stadium noch berücksichtigt werden könnten (Pkt. 5.7.2.).
Die verbleibende Abstrahlung einer entstörten Fernschreib-
maschine F 1100 muß durch zusätzliche Funkentstörmaßnahmen
an der kompletten Endstelle reduziert werden. Dazu sind wei-
tere Untersuchungen des Zusammenwirkens F 1000 mit peripheren
Geräten (Chiffriergeräte, Fehlerkorrekturgeräte usw.) erfor-
derlich. Im Punkt 5.7.3. werden einige Möglichkeiten aufge-
zeigt. um niedrige Funkstörungen zu erzielen.
5.7.2. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen an der FSM F 1000
Die Funkentstörmaßnahmen erstrecken sich auf hochfrequenzge-
rechte Masseführungen und Bezugspotentiale, den Anschluß aller
metallischen Teile an die Chassismasse, die Filterung der Tele-
grafieanschlußleitungen sowie die Quellentstörung einiger
wichtiger Baueinheiten.
Vorschläge und erreichbare Ergebnisse sind in Anlage 4
zusammengefaßt
5.7.3. Vorschläge zu Funkentstörmaßnahmen am Gesamtsystem
Folgende Maßnahmen und Forderungen können zur Verminderung der
Funkstörungen beitragen:
- Einsatz eines externen Netzfilters für die FSM F 1000 bzw.
für die gesamte Anlage (Dämpfung ≥ 40 dB),
(eventuell mit Pkt. 4.4. - Motorgenerator koordinieren),
- Forderung nach einer hohen Übersprechdämpfung der anzu-
schließenden Chiffriertechnik,
- Forderung nach einer hohen Übersprechdämpfung der anzu-
schließenden FKG oder Verbot des Anschlusses.
- einzuhaltende Mindestabstände
FSM zu benachbarter FSM 1 m
FSM zu abgeschirmten Chiffriergerät 0,5 m
FSM zum Linienanschluß 2 m
FSM einschließlich Chiffriertechnik
zu anderer Technik 5 m
- konkrete Aufstellungs- und Installationsvorschriften ein-
schließlich Kabel- und Leitungsführung, Auswahl von Kabel
und Leitungen (Schirmung) usw.
- Festlegungen zum Betriebsablauf
Diese ergeben sich aus den technischen Parametern der
peripheren Geräte.
6. Sonstige auswertbare Energien
Neben den Funkstörungen, die definitionsgemäß den Frequenz-
bereich oberhalb 10 KHz umfassen, sind auch niederfrequente
Energien als Magnetfelder und als Fremdspannungen vorhanden.
Die Ausbreitungsmöglichkeiten solcher Energien sind in /2/
angedeutet. Die Magnetfelder waren mit einfachen Indikatoren
noch im Abstand von 50 cm von der FSM nachweisbar. Genaue
Untersuchungen konnten aus zeitlichen und meßtechnischen
Gründen nicht durchgeführt werden.
Es wird eingeschätzt, daß nach Durchführung der im Pkt. 5.7.3.
aufgeführten Maßnahmen auch diese niederfrequenten Energien
abgeschwächt werden.
7. Zusammenfassung
Die elektronische FSM F 1000 erzeugt aufgrund ihres Wirkungs-
prinzips verschiedenartige Störenergien mit hohem Informations-
gehalt. Der Einsatz dieser FSM in Chiffrierstellen erfordert
entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung
dieser kompromittierenden Energien.
Während bei einigen energiearmen Störern (optische, akkus-
tische) relativ einfache Methoden zur Verhinderung der kompro-
mittierenden Abstrahlung ausreichen, erfordern andere Störer
(Stromaufnahmeänderungen) aufwendige, zusätzliche Maßnahmen
in der Chiffrierstelle.
Die Funkstörungen der FSM sind relativ energiearm, jedoch gut
von sonstigen Störern zu trennen. Ihre Ausbreitung ist deshalb
zu unterbinden. Diese Aufgabe kann nur durch eine Quellent-
störung an der FSM F 1000 und durch zusätzliche technisch-
organisatorische Maßnahmen in der Chiffrierstelle erfolgen.
Möglichkeiten mit einer Abschätzung ihrer Wirksamkeit sind in
den entsprechenden Kapiteln aufgezählt. Die Ausbreitung der
Funkstörungen auf der Telegrafieanschlußleitung ist dabei von
der Abstrahlungsfestigkeit anzuschließender Chiffriergeräte
abhängig und wurde bisher noch nicht umfassend untersucht.
Eine hochwertige Entstörung am Telegrafieanschluß der FSM ist
jedoch Voraussetzung für eine wirkungsvolle Gesamtentstörung.
8. Abkürzungen
lat. lateinisch
kyr. kyrillisch
Bd. Baud
OSZI Oszilloskop (Speicher-)
FSM Fernschreibmaschine (n)
LBS Lochbandstanzer
KES Karteneinschub
MM Markierungsmagnet
MS Stanzmagnet
MT Transportmagnet
M Mikrofon
NNB Netznachbildung
SMV Selektives Mikrovoltmeter
TK Tastkopf
HSM Horizontalschrittmotor.
VSM Vertikalschrittmotor
LSM Leserschrittmotor
SPM Schallpegelmesser
Fi Filter/Bandpaß
RL Lastwiderstand
9. Literaturverzeichnis
/ 1/ Einige Probleme der kompromittierenden Abstrahlung
neu entwickelter elektronischer Fernschreibmaschinen
des Systems F 1000 des Kombinats VEB Meßgerätewerk
Zwönitz, GVS-MfS-020-938/80
/ 2/ Einschätzung der Sicherheit einer Fernschreibendstelle
(Chiffrierstelle) bezüglich unberechtigter Erlangung
geheimzuhaltender Informationen mittels elektrischer
Auswertung, GVS-MfS-020-XI/718/79
/ 3/ Konzeption über die weitere Arbeit an der Problematik
der kompromittierenden Abstrahlung von Chiffrier- und
Nachrichtentechnik - Studie -, GVS ZCO 216/81.
/ 4/ "Regelungen und Bestimmungen für das Chiffrierwesen
der DDR" vom 30. 3. 1977, GVS B 434-401/76
/ 5/ "Sicherheits-. und technische Bestimmungen für den
Einsatz kanalgebundener Chiffriertechnik in stationären
und mobilen Einrichtungen des Chiffrierwesens"
vom 13. 09. 1977, GVS B 434-402/76
/ 6/ TGL 20885/06 Ausgabe 2/79
/ 7/ TGL 20885/16 Ausgabe 12/79
/ 8/ St RGW 784-77
/ 9/ St RGW 502-77
/10/ RS 1932-69
/11/ RS 1929-69
/12/ RS 1953-68
/13/ Serviceanleitung F 1200
/14/ Satz Zeichnungsunterlagen F 1301
Anlage 1
Druckbilder F 1100
Druckbild lateinische Großbuchstaben
Druckbild lateinische Kleinbuchstaben
Druckbild kyrillische Großbuchstaben
Kodebelegung Fernschreiber F 1100
Tabelle 1 Anzahl der Druckpunkte
der Druckspalten 1 … 5
für lateinische und
kyrillische Buchstaben
Tabelle 2 Anzahl theoretisch unterschiedlicher
Klassen für verschiedene
Fernschreibvarianten

Kodebelegung Fernschreiber F 1100
Tabelle 1: Anzahl der Druckpunkte der Druckspalten 1 … 5
für lateinische und kyrillische Buchstaben
| Anzahl der Druckpunkte | lateinische Buchstaben | kyrillische | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Druckspalte | groß | klein | Buchstaben | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | B | B | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Б | ||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | E | E | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | Ы | ||
| 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | R | ||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | D | b | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | P | P,Ь | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | F | ||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | N | И | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | Ю | ||
| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | Ш | ||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | K | K | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | M, W | M | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | k | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | H | H, П | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | h | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | L | Г | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | A | A | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | p | ||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | Щ | ||
| 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | Ц | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | U | ||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | Q | ||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | G | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | O | Й, O | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | C | |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | m | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | n | ||
| 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | Ж | ||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | X | X | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | w | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | u | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S, Z | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | e | ||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | Я | ||
| 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | Ф | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | d | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | V | o | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | c | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | y | ||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | Y | ||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | У | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | v | ||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | Д | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | g | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Э | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | s, z | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | З | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | q | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | ||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | Л | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | a | ||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | T | T | |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | J | ||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | j | ||
| 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | r | ||
| 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | I | ||
| 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | i | ||
| 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | f | ||
| 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | t | ||
| 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | l | ||
| Tabelle 2: Anzahl theoretisch unterscheidbarer Klassen für | |||||||
| verschiedene Fernschreibvarianten | |||||||
| Variante | Anzahl der Buchstaben | Anzahl der Klassen |
|---|---|---|
| Lateinische Großbuchstaben | 26 | 24 |
| Lateinische Kleinbuchstaben | 26 | 25 |
| Lateinische Groß- und Kleinbuchstaben | 52 | 47 |
| Kyrillische Buchstaben | 30 | 27 |
| Lateinische und kyrillische Großbuchstaben | 56 | 38 |
Anlage 2
Meßprotokoll über die Messung von Funkstörungen F 1100
1. Erzeugnis : elektronische Fernschreibmaschine F 1100
2. Gerätenummer: 09029 und 09078
3. Herstellungsdatum: 1980
4. Hersteller: VEB Kombinat Meßgerätewerk Zwönitz
9417 Zwönitz
Schillerstraße 13
5. Grenzwerte der Funkstörungen:
| Funkstörspannung auf Netz | (F1) | F1-20 dB |
| Funkstörspannung auf der | F1 +30dB | F1 +10dB |
| Fernmeldeanschlußleitung | ||
| Funkstörfeldstärke | 100 μV/m in 10m | 50μV/m in 1 m |
| Entfernung | Entfernung |
6. Meßverfahren: nach TGL 20885
Die TGL 20885 entstand unter Berücksich-
tigung entsprechender RS-Empfehlungen
und enthält Festlegungen von
RGW-Standards
(RS 1929 - 69
RS 1932 - 69
RS 1953 - 68
ST RGW 784-77)
ST RGW 502-77 ist nicht berücksichtigt.
7. Meßgeräte: Selektives Mikrovoltmeter SMV 6.5
Geräte-Nr. 07204
mit Feldstärkemeßantenne FMA 6.2
Geräte-Nr. 04/115
mit Netznachbildung NNB 101
Geräte-Nr. 08317
und Tastkopf TK 102
Geräte-Nr. 09700
Selektives Mikrovoltmeter SMV 8.5
Geräte-Nr. 02200
mit Dipolantenne DP 1
und Netznachbildung NNB 103
Geräte-Nr. 04/262
8. Meßbedingungen: Standardmeßbedingungen
nach TGL 20 885
9. Betriebsart dar Fernschreibmaschine:
- Netzbetrieb 220 V Ws, 50 Hz
- Fernmeldeanschluß siehe Meßaufbau
Die TGl 20885/16 , Meßverfahren und Grenzwerte für Draht-
fernmeldeanlagen, enthält keine Aussage über Anordnung und
Größe der Nachbildwiderstände, mit denen die Fernmeldean-
schlußleitung einer Fernschreibmaschine abzuschließen ist.
Netznachbildungen für Fernmeldeanschlußleitungen standen
nicht zur Verfügung.
- In Anlehnung an Störspannungsmessungen auf Leitungen wurden
die Fernmeldeanschlußleitungen und Steuerleitungen gemäß
Meßaufbau mit 8 Nachbildwiderständen zu je 600 Ω belastet.
- Stanzer eingeschaltet, Leser eingeschaltet, Lokalbetrieb
- Leser mit eingelegtem Lochstreifen, Mischtext
10. Meßaufbau für Funkstörspannungsmessungen:
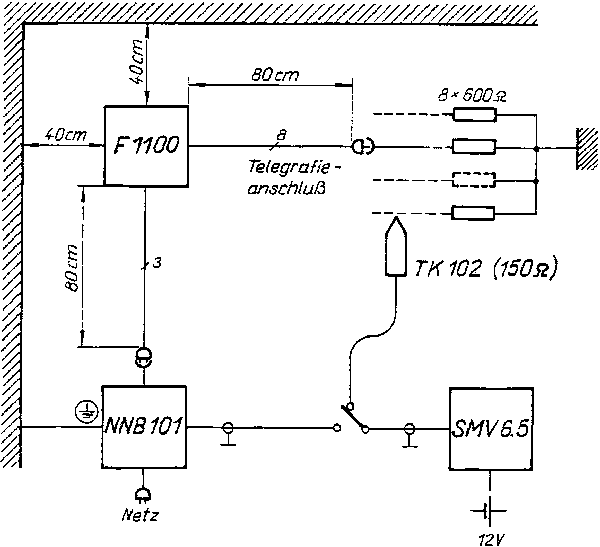
11. Meßergebnisse Funkstörspannung siehe Diagramm 1: Kurve 1 Störspannung auf Netz, FSM Nr. 09078 Kurve 2 Störspannung auf Netz, FSM Nr. 09029 Kurve 3 Störspannung auf Kurve 4 Störspannung auf Fernmeldeanschlußleitung, FSM Nr. 09029 12. Meßaufbau zum Messen der Funkstörfeldstärke:
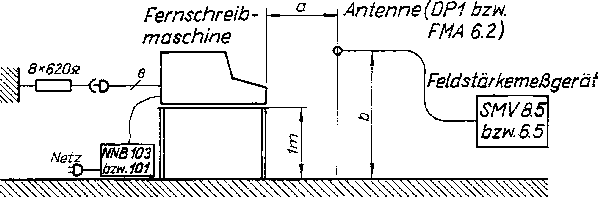
Höhe b der Antenne auf maximale Feldstärke einstellen
(für a = 1 m beträgt b ≈ 1,50 m )
13. Meßergebnisse Funkstörfeldstärke:
Meßabstand a = 10 m: Funkstörfeldstärke unterhalb Nachweis-
grenze des Meßgerätes
Meßabstand a = 3 m: Funkstörfeldstärke unterhalb Nachweis-
grenze des Meßgerätes
Meßabstand a = 1 m: siehe Diagramm 2
Kurve 1 Funkstörfeldstärke FSM Nr. 09078
Kurve 2 Funkstörfeldstärke FSM Nr. 09029
Kurve 3 Nachweisgrenze des Meßgerätes
(je nach Rauschanteil kann die Grenze
noch bis zu 10 dB unterboten werden)
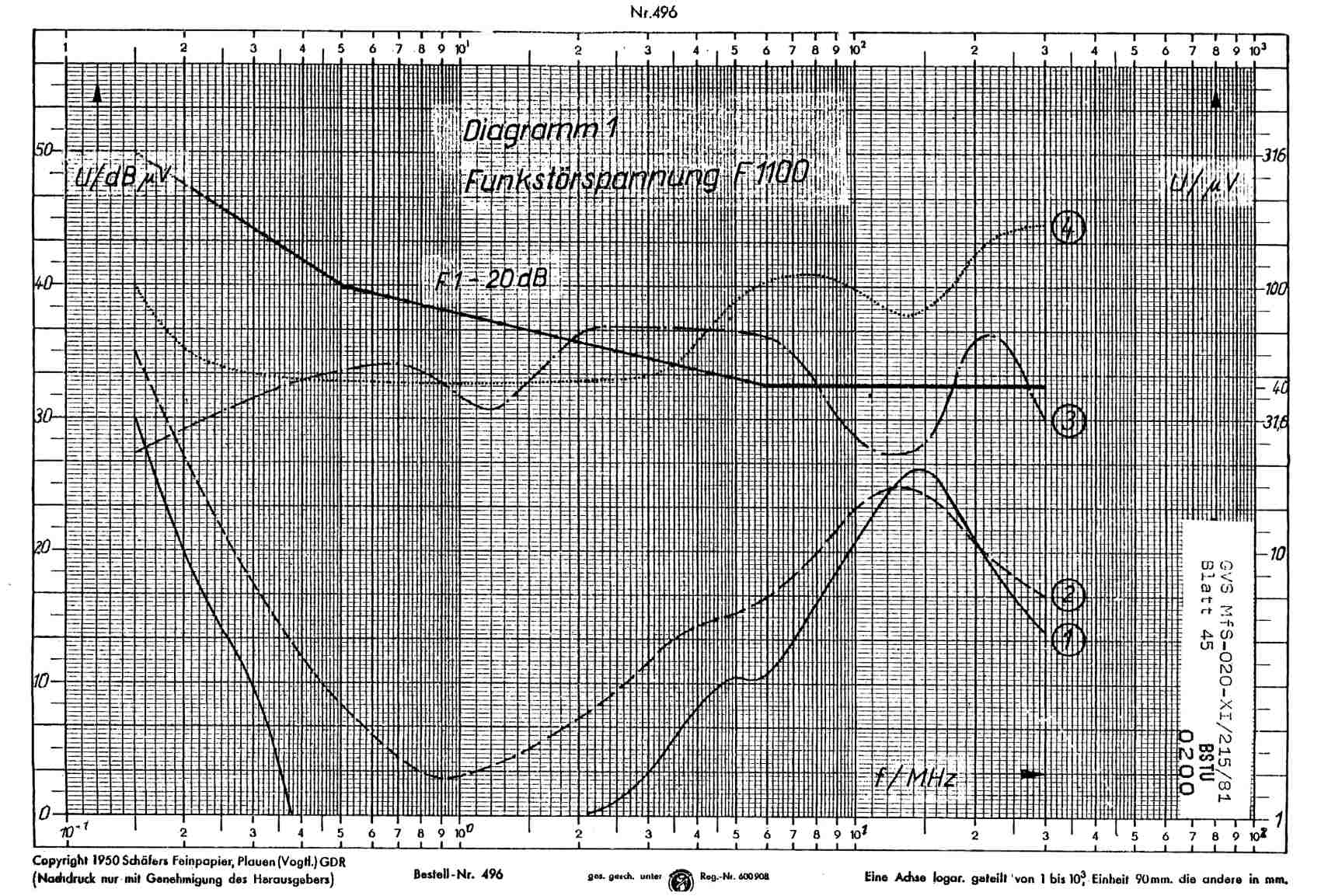
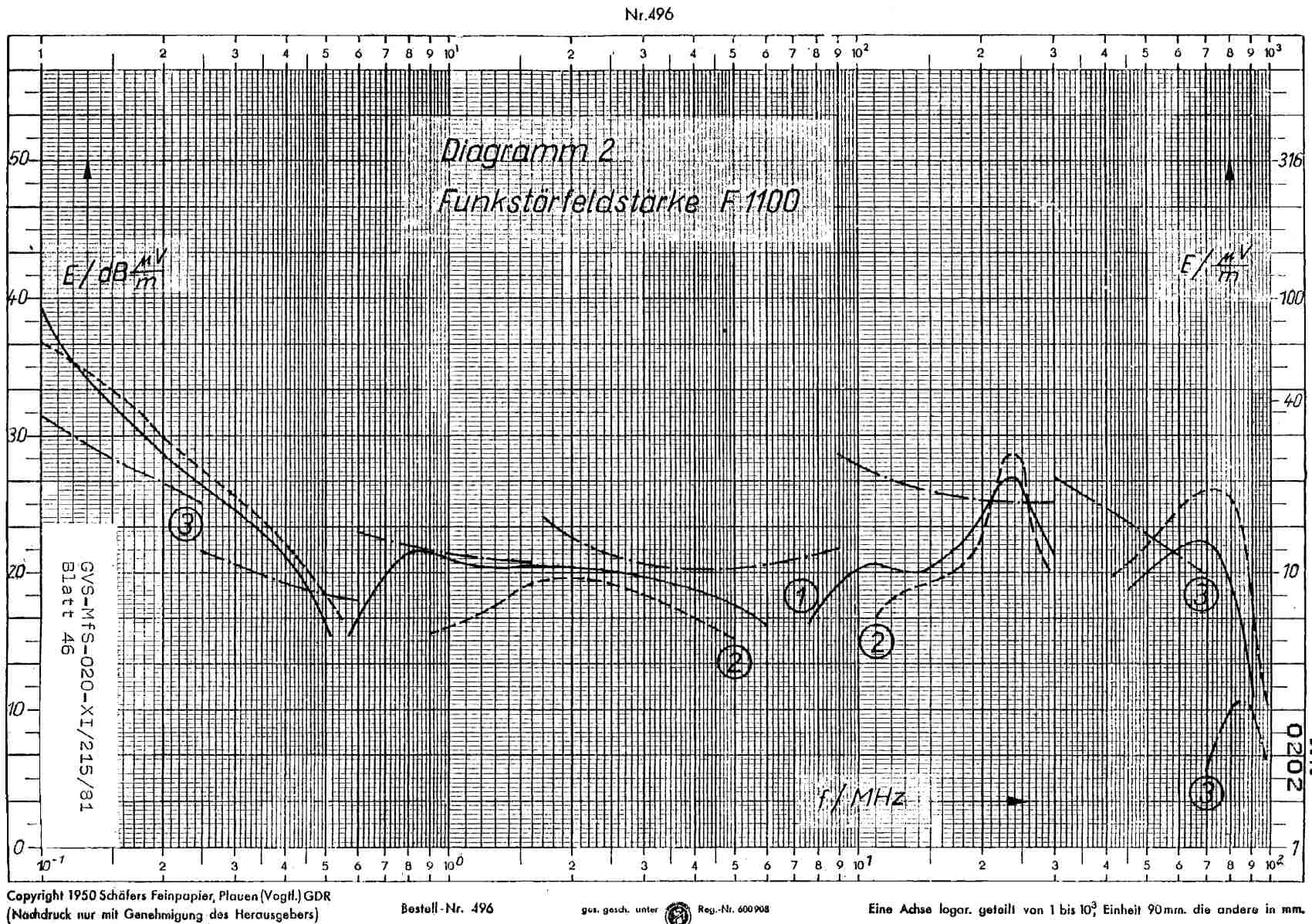
Anlage 3
Funkstörspannungsanteile einzelner Störquellen der
FSM F 1100
Diagramm 1 Funkstörspannung der Taktoberwellen auf FSAL
Diagramm 2 Funkstörspannung der Taktoberwellen auf FSAL
Parameter RLinie
Diagramm 3 Funkstörspannung Nadelendstufen u. Taktober-
wellen
Diagramm 4 Funkstörspannung Netz, verschiedene Störer
Diagramm 5 Funkstörspannung Netz, Parameter RLinie
Diagramm 1
Hüllkurven der Störspannung Taktoberwellen auf der Telegrafie-
anschlußleitung F 1100 ( b-Ader ) Gerät Nr. 09078
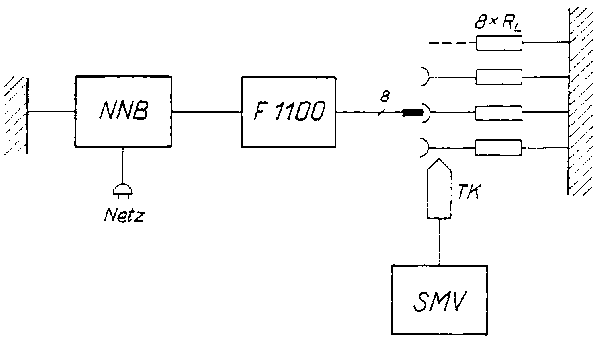
1. Lastwiderstände RL = 620Ω Tastkopf TK 102 (150Ω) 2. Lastwiderstände R = 620Ω Tastkopf TK 103 (2,5kΩ) 3. Lastwiderstände RL = ∞ Tastkopf TK 102 (150Ω) Hüllkurve einschließlich Netzteilstörungen Polstelle um 12 MHz
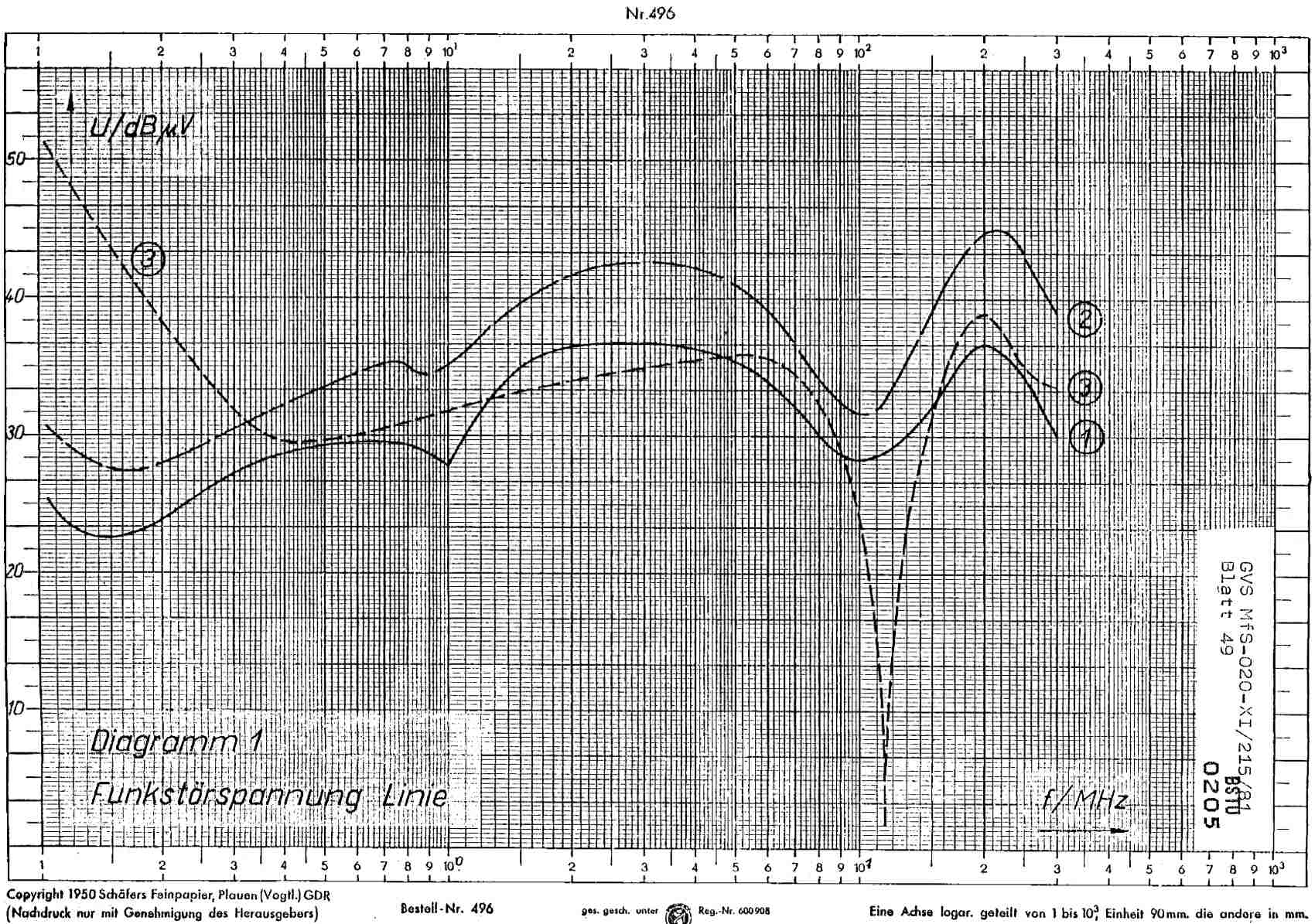
Diagramm 2 Hüllkurve der Störspannungen Taktoberwellen auf der Telegrafieanschlußleitung F 1100 (b-Ader) Gerät Nr. 09029 ohne Lochbandgerät
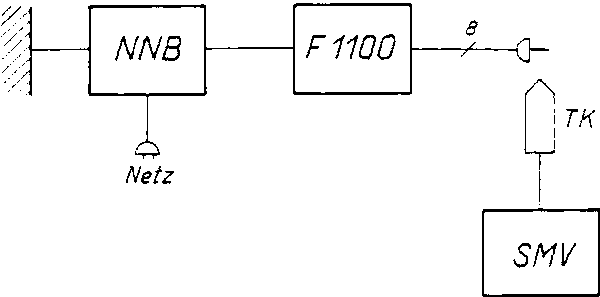
1. Tastkopf TK 102 (150Ω) 2. Tastkopf TK 103 (2,5kΩ)
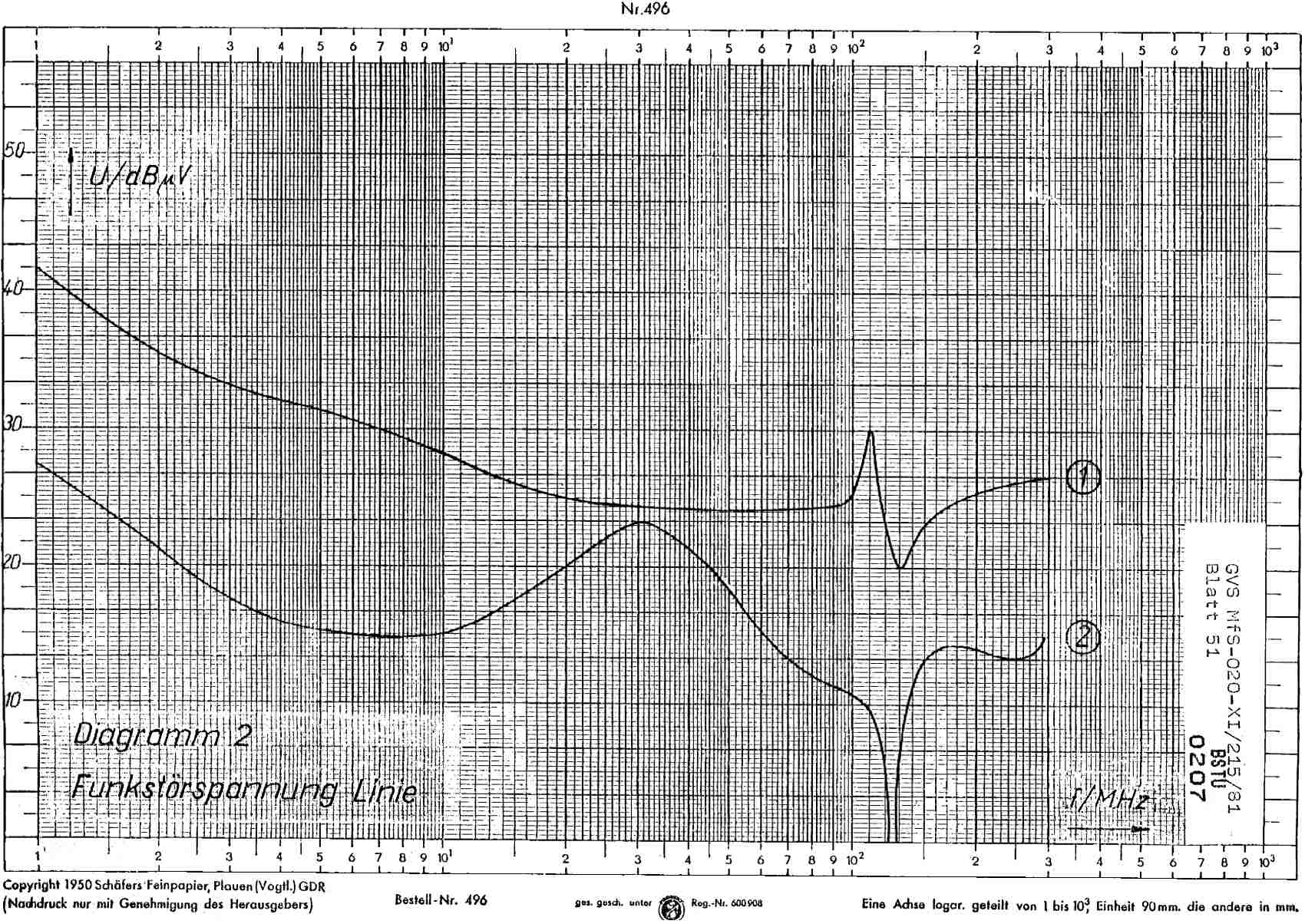
Diagramm 3 Funkstörspannung auf der Telegrafieanschlußleitung F 1100 (b-Ader) Gerät Nr. 09078
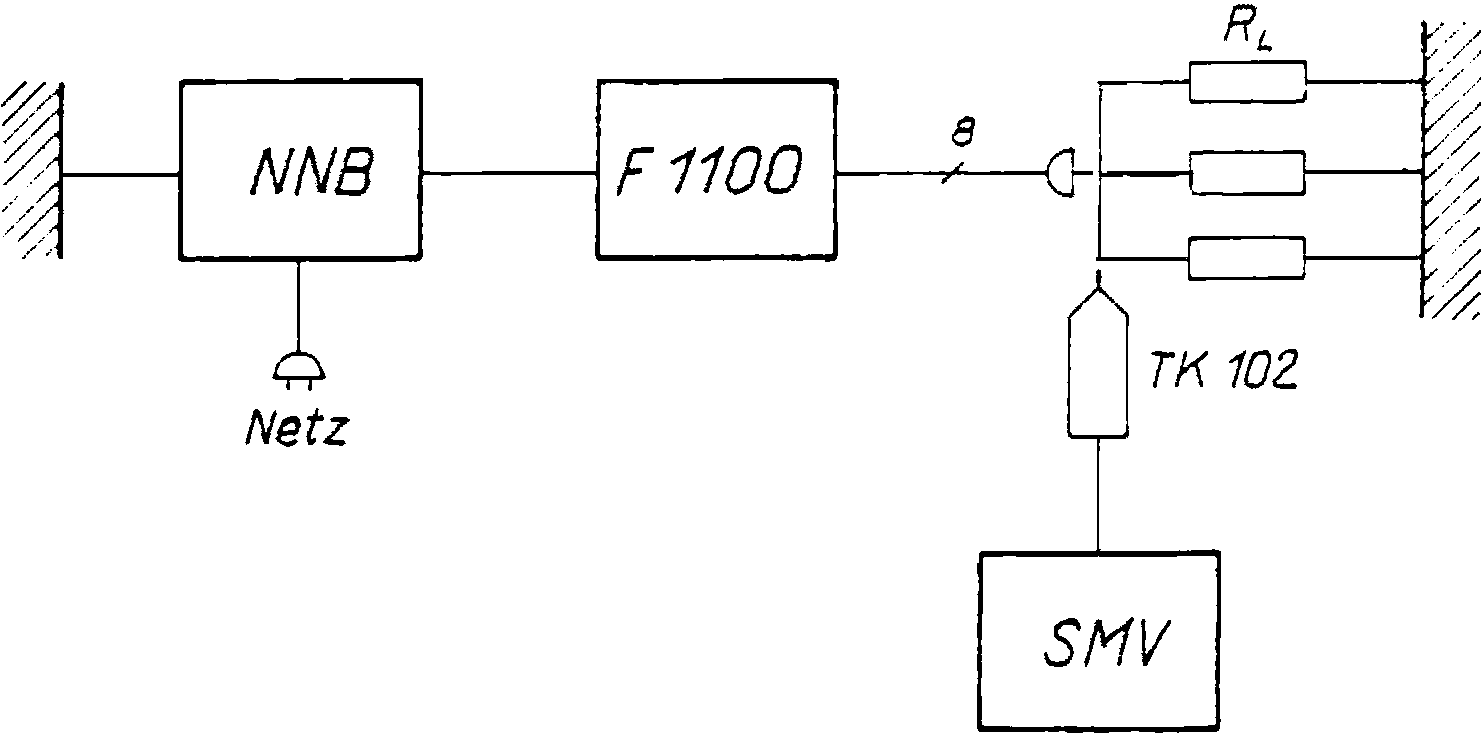
1. Hüllkurve Taktoberwellen RL = 620Ω TK 102 (150Ω) 2. Hüllkurve Taktoberwellen und Netzteil RL = ∞ TK 102 (150Ω) 3. Störspannung vom Druckwerk (Schrittmotore und Nadelendstufen) RL = ∞ TK 102 (150Ω) Mischtext, 100 Baud
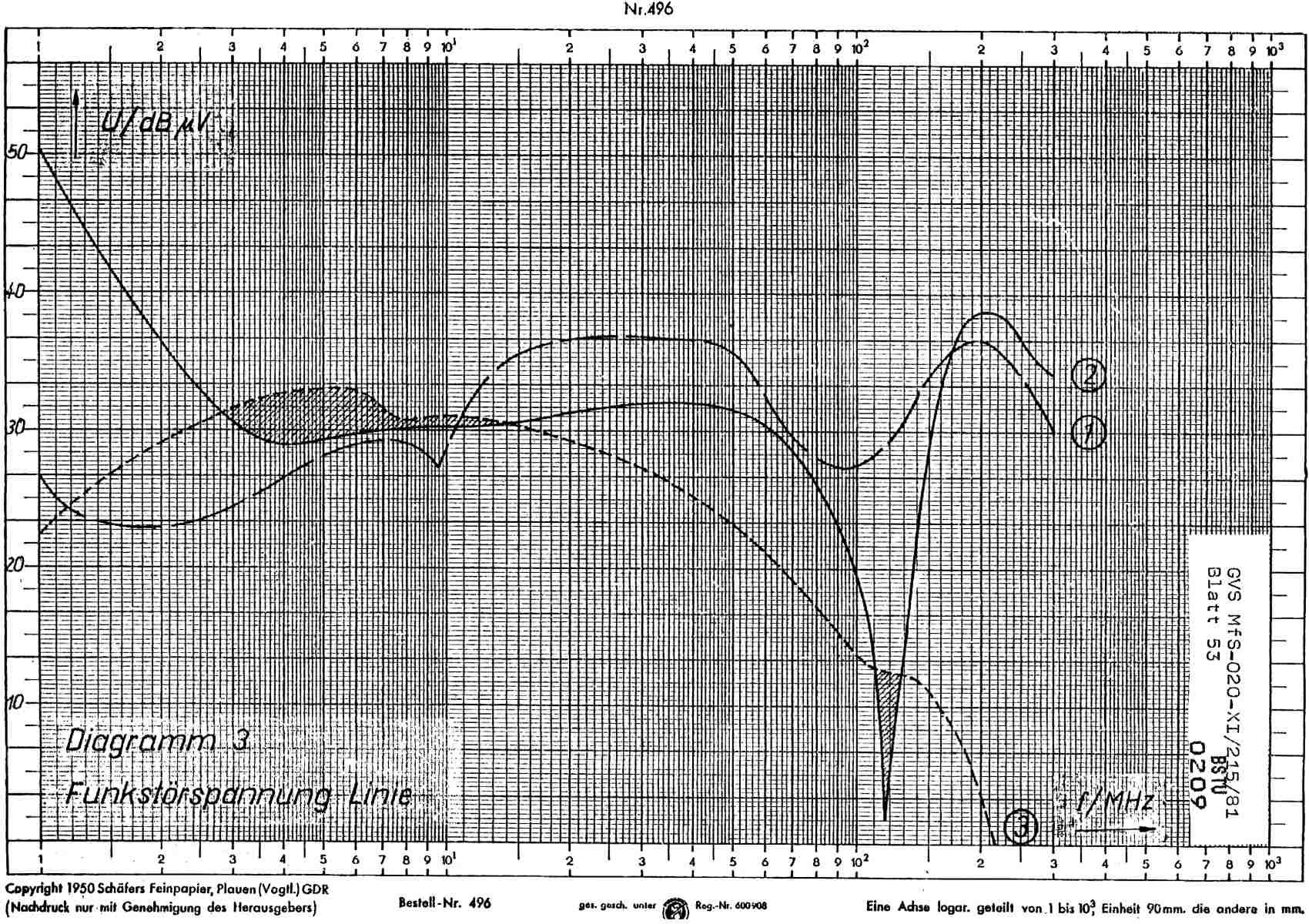
Diagramm 4 Funkstörspannung Netz
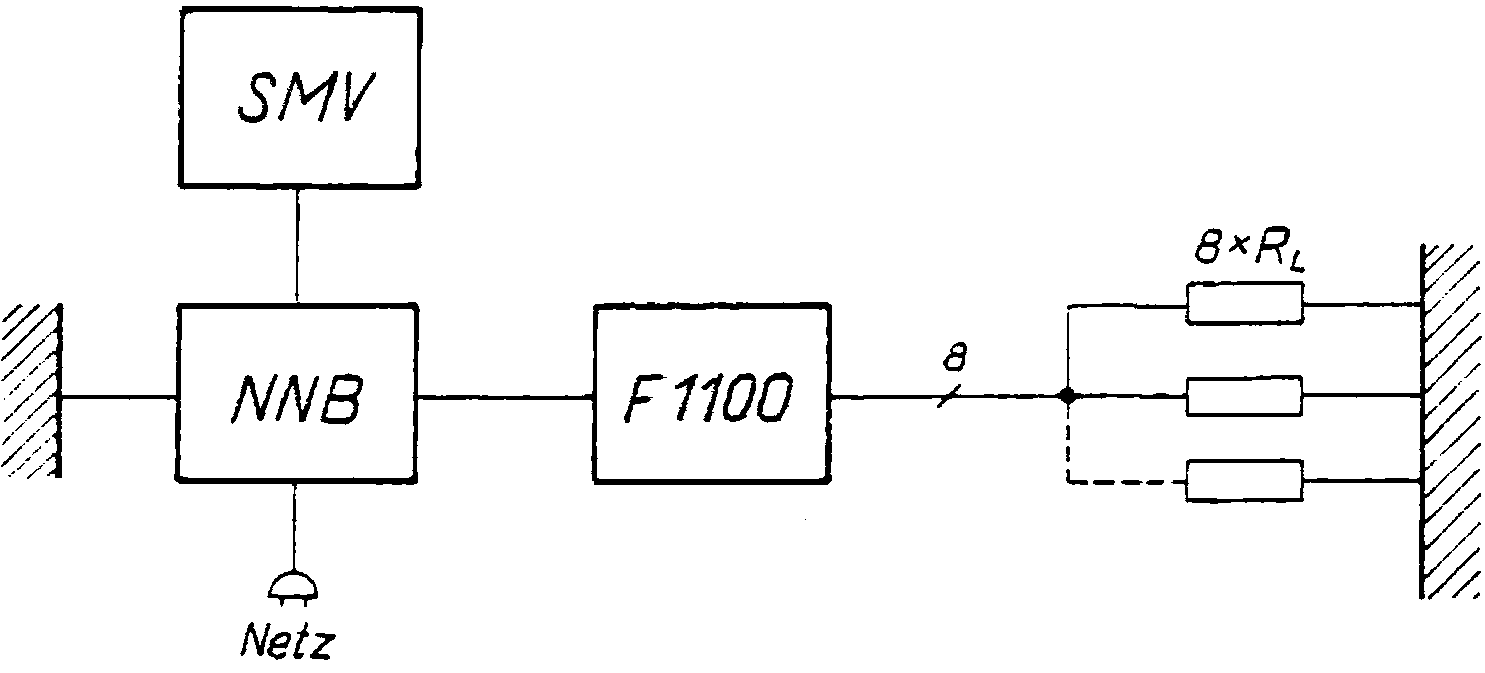
1. Störspannung Netz NNB 101 ohne Signalverarbeitung 2. Störspannung Netz NNB 103 ohne Signalverarbeitung 3. Störspannung des Stanzers, 100 Bd. 4. Störspannung des Zeilenschrittmotors (= Zwischenraum, 100 Bd.) 5. Störspannung der Nadelmagnete
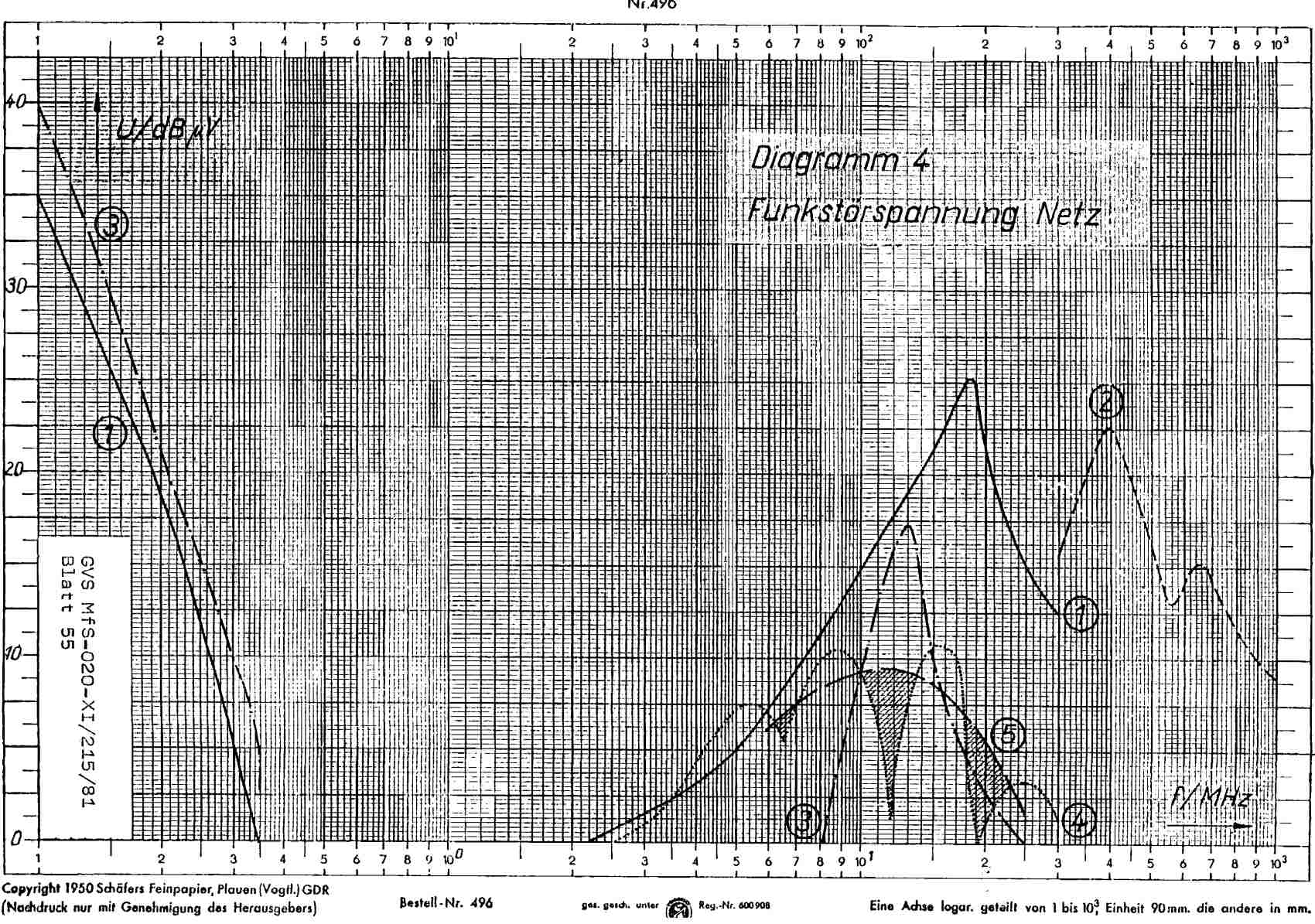
Diagramm 5 Funkstörspannung Netz, Gerät Nr. 09078
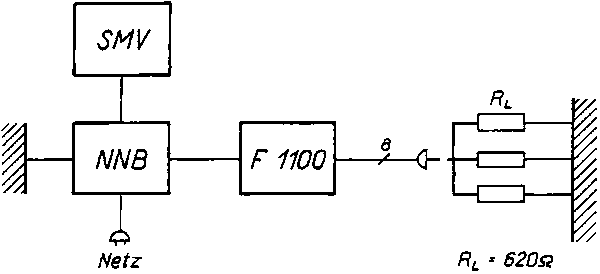
1. RL = 620 Ω 2. RL = ∞
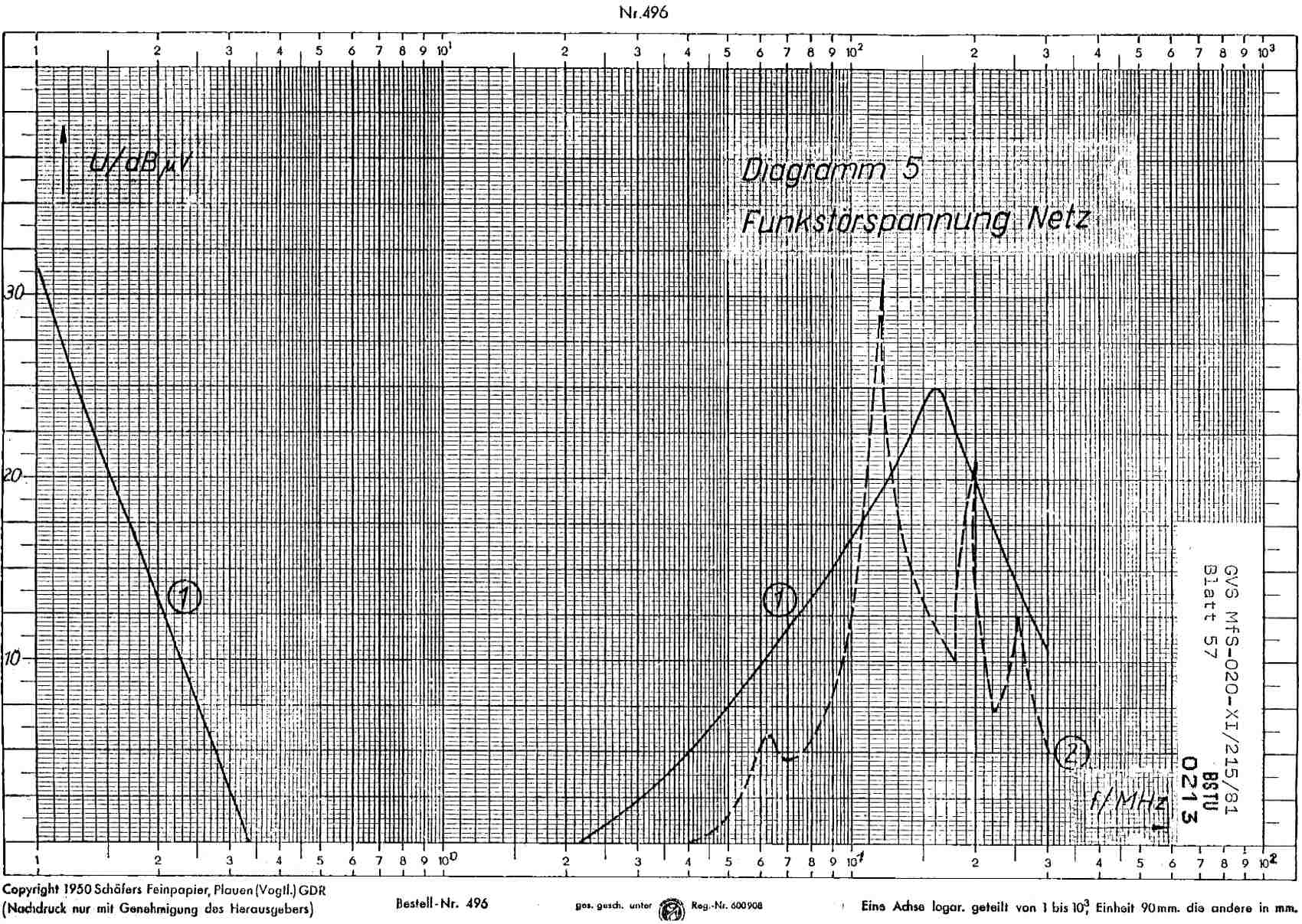
Anlage 4
Technische Funkentstörmaßnahmen an der FSM F 1000
1. Voraussetzungen
Nachfolgend genannte Entstörmaßnahmen stellen Minimalforderun-
gen dar, die den erreichten Entwicklungsstand des Gerätes
berücksichtigen.
2. Technische Änderungen
2.1. Drucker- und Schrittmotorsteuerung (Karte EN/1; Angaben
nach 3511.411 - 01722 Sp ( 1 )
2.1.1. Zur Verlangsamung von Schaltflanken sind die Endstufen für
die Nadelmagnete mit "Miller-Kondensatoren" zu beschalten
(zwischen Basis und Kollektor der Transistoren V 33 … V 40
jeweils z. B. 33 nF).
2.1.2. Die Flankensteilheit der Ansteuerimpulse für der Druckwagen-
bzw. Walzenschrittmotor ist herabzusetzen (z. B. zwischen
Basis und Kollektor der Transistoren V 43, V46 … V 49,
V 63 und V 66 … V 69 jeweils 1 nF).
2.2. Tastatur
2.2.1. Es ist innerhalb der Baugruppe eine zuverlässige Massever-
bindung aller Metallteile von Rahmen und Befestigungselemen-
ten sowie der Tastaturabdeckung (Stanzteil mit Aussparungen
für die Tasten) zu schaffen (z. B. durch Schraubverbindungen,
Masseverbindungsleitungen).
2.2.2. Die Baugruppe ist weitgehend zu schirmen, insbesondere auch
nach unten (z. B. durch Bodenblech).
2.3. Telegrafieanschlußleitung
2.3.1. Es ist eine Filterung aller Adern der Anschlußleitung
zu realisieren. Dazu sind diese mit mindestens 33 nF
(keine Wickelkondensatoren) gegen Masse abzublocken
(z. B. mit Durchführungskondensatoren nach TGL 24 101 in
entsprechendem Filtergehäuse; bei Verwendung von Schei-
benkondensatoren maximale Anschlußlänge 20 mm).
2.3.2. Der Schirm der Telegrafieanschlußleitung muß eine zu-
verlässige Masseverbindung haben (z. B. Schraubverbin-
dung auf dem Chassissteg zwischen L 1 und Steckverbinder
X 15) und im gleichen Punkt erfolgen wie die Massever-
bindung der Filterkondensatoren.
2.3.3. Alle ungeschirmten Leitungsenden der Telegrafiean-
schlußleitung sind auf das unbedingt notwendige Maße
zu kürzen.
2.3.4. Es ist auf den FKG-Anschluß zu verzichten und für die
Anschlußleitung 4adriges geschirmtes Kabel zu ver-
wenden. Bei Verwendung von 8adrigem Kabel sind die
freien Adern mit dem Schirmerdungspunkt zu verbinden.
2.3.5. Bei Beibehaltung des FKG-Anschlusses ist Anschluß 7
(FKG-Masse) direkt mit dem Schirmerdungspunkt zu verbin-
den und alle anderen Anschlüsse wie unter Punkt 2.3.1.
zu filtern.
2.4. Netzanschluß, Entstörsatz 3511.411-01905
2.4.1. Anstelle von C 1 sind 2 Breitband-Entstörkondensatoren
0,05 μ + 2x 1250/250 vorzusehen, davon je einer im Netz-
filtereingang bzw. -ausgang.
2.4.2. Dafür entfällt C 5.
2.4.3. Die Netzanschlußleitung ist zu schirmen.
2.5. Masseverbindungen und Stromversorgungsleitungen
2.5.1. Die Kondensatoren C 1 und C 2 sind gegen das Druckwerk-
chassis zu isolieren. Zwischen dem Druckwerkchassis und
dem tragenden Chassis ist eine Masseverbindung (mit min-
destens 2,5 mm Cu Litze, Länge 50 mm) herzustellen.
2.5.2. Es ist eine zuverlässige Masseverbindung des Tastatur-
rahmens zum Grundchassis (z. B. Masseverbindungsleitung
entsprechenden Querschnitts oder Schraubverbindung
Rahmen-Chassis) zu schaffen.
2.5.3. Die Frontplatte (mit LED-Anzeige) ist mit der Geräte-
masse zu verbinden.
2.5.4. Die Masseverbindung der Bodenbleche ist durch metallisch
blanke Verbindungsstellen und die Verwendung von mindes-
tens einer Zahnscheibe je Bodenblech zu verbessern.
2.5.5. Die gleichen Maßnahmen ( wie Punkt 2.5.4.) sind beim
Einsatz einer metallischen rückseitigen Gehäuseschale
zu realisieren.
2.5.6. Die Leitungsführung und der Querschnitt von Masse - und
Speiseleitungen sind günstiger zu gestalten. Im Interesse
von kürzestmöglichen Leitungen sind diese ggf. nicht in
Kabelbäumen zu führen. Der Querschnitt, insbesondere von
Masseleitungen (z. B. zur Tastaturbaugruppe), ist zu
vergrößern (z. B. auch durch Einsatz von Sammelschienen).
2.6. Telegrafierstromanzeige
Die vorhandene Lösung ist dahingehend zu ändern, daß keine
Anzeige der zeichenabhängigen Telegrafierstromunterbrechungen
erfolgt. Es werden folgende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen:
a) Verzicht auf diese Anzeige (d. h. LED V1 entfällt);
b) Änderung der LED-Ansteuerung derart, daß obige Forderung
erfüllt wird (z. B. durch ein zusätzliches Zeitglied auf
Karte 3511.411-01784 ähnlich dem Zeitglied 4 auf Karte FE/l).
3. Ergebnisse
Durch die genannten Maßnahmen wird insbesondere eine Verringerung
der Störspannung auf dem Telegrafieanschluß um ca. 10 dB und eine
Verringerung der speziellen informationshaltigen Funkstörungen
des Druckers (vgl. Bl. 21, Punkt 5.3.2.) um ca. 16 dB sowie der
Schrittmotoren (vgl. Bl. 25, Punkt 5.4.3.) um 10 … 20 dB
erreicht.
Gleichzeitig sollen damit die Funkstörungen der Tastatur (vgl.
Bl. 22, Punkt 5.3.3.). verringert werden. Dazu liegen noch
keine Ergebnisse vor.
Weiterhin wird eine mögliche optische Auswertung verhindert.
Anlage 5 Stromlaufplan EN/1
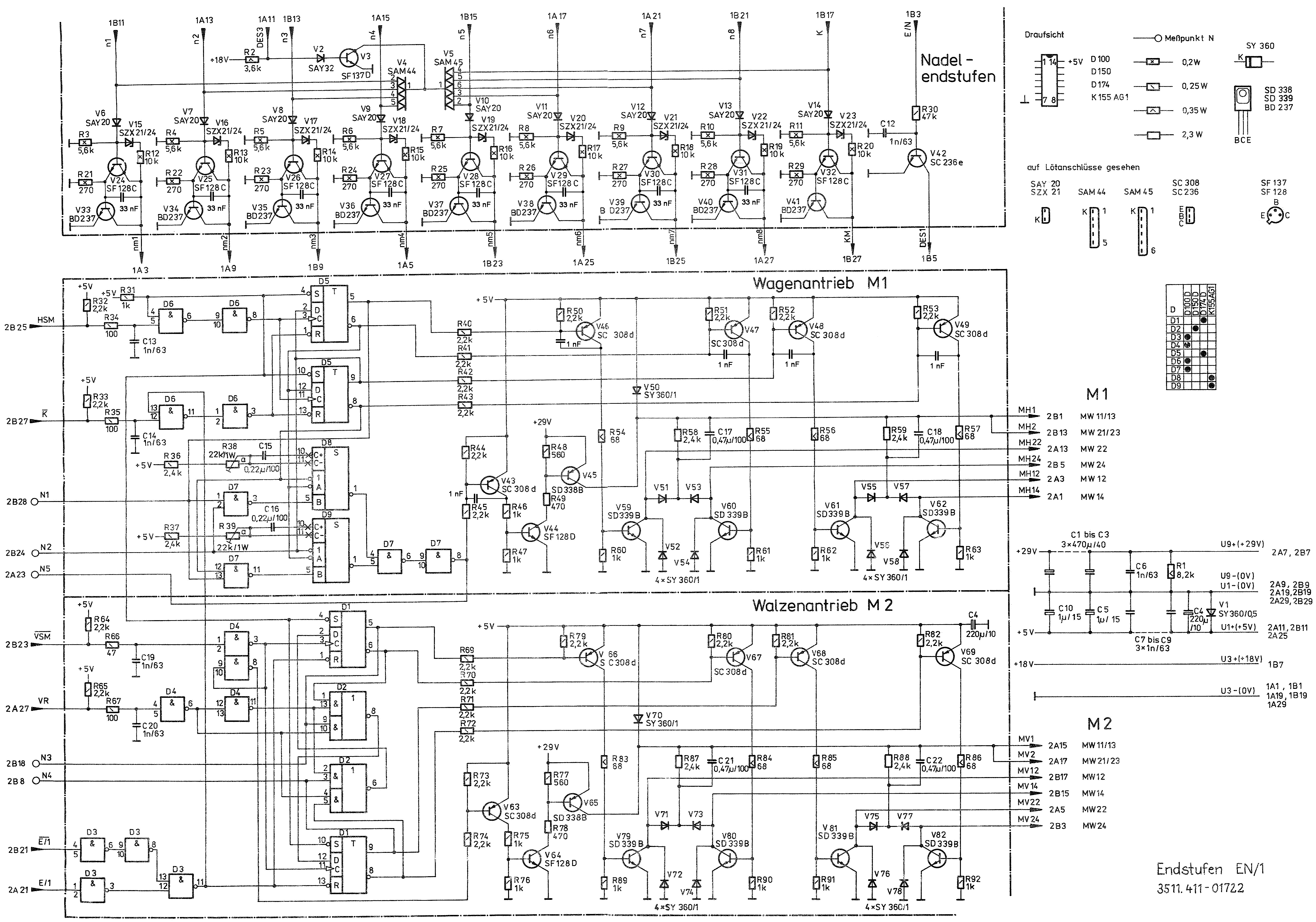
Anlage 6 Anschlußplan ADo-8

Anlage 7 Netzleitungsfilter
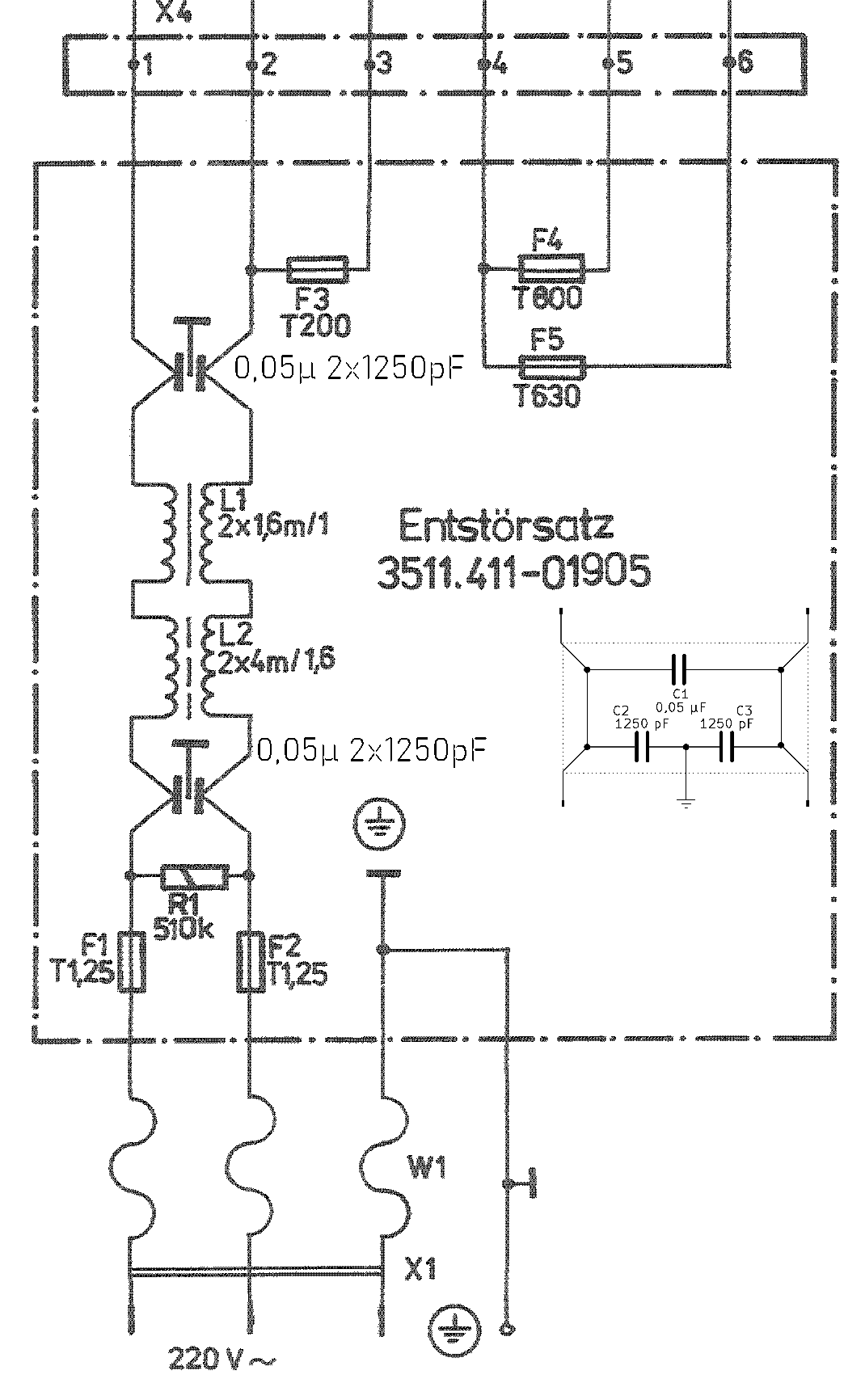
Kombinat VEB Meßgerätewerk Zwönitz Vertrauliche Verschlußsache
9417 Zwönitz, Schillerstr. 13 KR-2/1-50/77
22. Ausfertigung 7 Blatt
Rahmenpflichtenheft Teil I
Volkswirtschaftliche Zielstellung für die wissenschaftlich-
technische Aufgabe
Bezeichnung des Erzeugnisses: Fernschreiber F 1301
aus der Gerätefamilie F 1000
Einführungsjahr: Nullserie 1982
1. Serie 1983
Soll durch das Erzeugnis zum Zeitpunkt der Produktionswirksam-
keit der fortgeschrittene internationale Stand bestimmt oder
mitbestimmt werden?
ja / nein
Verantwortlicher Themenleier: Dipl.-Phys. Müller
Komplexthemenleiter: Ing. Glöckner
Auftraggeber: MfNV
Hersteller: Kombinat
VEB Meßgerätewerk Zwönitz
Anwender: Sonderbedarfsträger in der DDR
Das Pflichtenheft wurde am ... in der K 1-Verteidung verteidigt.
Der volkswirtschaftlichen Zielstellung wird zugestimmt.
gez. Dipl.-Ing. Sommer gez. i. V. Derlath, Oberst
...................... ..........................
ASMW MfNV
Leipzig, den 7. 11. 1978 Zwönitz den 10. 10. 1977
Deubner Döring
amt. Generaldirektor VVB NuM Kombinatsdirektor VEB KMWZ
1. Volkswirtschaftliche Zielstellung
1.1. Zu erreichende wissenschaftlich-technisches und ökonomisches
Niveau
Auf der Grundlage einen zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer abgeschlossenen Wirtschaftvertrages zur Durchführung
militärtechnischer F/E-Vorhaben (Vertragsnummer 7-62/1-14/5-K)
vom 10.8.77 sind ein elektronischer Fernschreiber für spezielle
Verwendung zu entwickeln.
Zur Absicherung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
und einer hohen ökonomischen Effektivität ist das neue
Erzeugnis
Fernschreiber F 1301
als zweisprachige 3-Register-Variante der zivilen Geräte-
familie F 1000 mit Mindestanforderungen der Sonderbedarfsträger
auszulegen, wobei ein Wiederholteilgrad von ca. 95 % zu
der in Entwicklung befindlichen zivilen 2-Registermaschine
F 1001 anzustreben ist.
Der Fernschreiber F 1301 ist eine komplette Fernschreibend-
stelle, mit der ab 1983 der mechanischen Fernschreiber T 63
SU 13 abgelöst werden soll.
Durch den Einsatz des F 1301 werden Rationalisierungseffekte
und die Umweltbedingungen beim Bedarfsträger sowie deren
Bedarfsdeckung weiter verbessert.
Für das technische Niveau gelten die CCITT-Empfehlungen,
die einschlägigen Standards sowie die Abstimmung mit dem
Sonderbedarfsträger und den ASMW.
Für das ökonomische Niveau gilt eine Forderung nach maximaler
Zahl von Wiederholbaugruppen innerhalb der Gerätefamilie
F 1000 speziell zum Fernschreiber F 1001 sowie die Unabhängi-
keit von NSW-Bauelementen.
Die technisch-ökonomischen Zielstellung müssen dem fortge-
schrittenen internationalen Niveau entsprechen.
1.2. Kurzcharakteristik
Zu entwickeln ist ein elektronischer Blattfernschreiber mit
Lochbandgerät, der im internationalen Telegrafenalphabet Nr. 2
mit umschaltbaren Telegrafiegeschwindigkeiten 50, 75, 100 Bd
in Wähl- und Standverbindungen arbeitet und Zusatzforderungen
der Sonderbedarfsträger erfüllen muß.
Schriftart: Lateinisch und Kyrillisch
Großbuchstaben
Der Fernschreiber F 1301 hat die gleiche Beständigkeit gegen
klimatische und mechanische Beanspruchungen wie der zivile
Fernschreiber F 1001.
Bei höherer mechanischer Belastung wird der Fernschreiber
F 1301 zur Dämpfung auf einen Schwingrahmen befestigt.
Bei der Wahl der Funktionsprinzipien ist auf eine hohe Zuver-
lässigkeit, Verschleißarmut und Umweltfreundlichkeit (niedriges
Arbeitsgeräusch) besonders zu achten. Der Fernschreiber ist
nach dem Baukastenprinzip aufzubauen.
1.3. Technische Daten
Kode Internationales Telegrafenalphabet Nr. 2
Schrittgeschwindigkeit 50, 75, 700 Bd Umschaltbar
Telegrafiestrom 16 ... 70 mA
Telegrafiespannung ≤ 130 V
Netzspannung 220 V +10%, -15%
Druckprinzip Nadelrasterdruck
Fernschreiberpapier Rollenpapier nach TGL 2848
208 ... 216 mm Breit
Zeilenabstand 1-1,5-2 fach umschaltbar
Register 3
Volumen ca. 70 l ]
Präzisierung 11/78 ca. 73 l } ohne Schwingrahmen
Masse max. 35 kg |
Präzisierung 11/78 max. 34 kg ]
Größere Masse gegenüber F 1001 durch
Realisierung der Zusatzforderungen.
1.4. Weltstandsvergleich
Für den Fernschreiber F 1301 wird der Weltstandsvergleich
des Fernschreibers F 1001 herangezogen.
Dabei ist zu beachten, daß der F 1001 ein 2-Registermaschine
darstellt. Der F 1301 hingegen hat einen höheren Gebrauchs-
wert, da er generell als zweisprachiges 3-Registermaschine
ausgelegt ist.
Weiterhin werden Zusatzforderungen der Sonderbedarfsträger
realisier, die wegen des speziellen Charakters des Gerätes
F 1301 nicht mit zivilen Fernschreibern verglichen werden
können.
Die größer Masse des F 1301 (max. 35 kg) gegenüber dem F 1001
wird durch Realisierung der Zusatzforderungen verursacht.
Der Weltstandsvergleich des F 1001 ist im Pflichtenheft Teil I
vom F 1001 enthalten (VVS KR 2/I-49/77).
2. Ökonomische Kennziffern
Die Planung und Einschätzung aller ökonomischen Kennziffern
des F 1301 basierend auf einer Wiederholteilgrad von ca. 95%
der zivilen Fernschreiber F 1001, d. h. gemeinsame Fertigung
der Fernschreiber F 1301 und F 1001 bis zur Komplementierung
und auf einer hohen Produktionsstückzahl von etwas 800 Stück/Jahr
(Orientierungsstückzahl des MfNV).
Da beim F 1301 die gleiche Problematik - Verlagerung der
Schrittschaltmotore und Tastatur - wie beim F 1001 noch
nicht geklärt ist, wurden auch hier zwei Varianten erarbeitet:
- Variante 1: F 1301
ohne ohne Schrittschaltmotor und Tastatur
- Variante 2: F 1301
mit Schrittschaltmotor und Tastatur
Im Punkt 2.5. und 2.6. wurde grundsätzlich mit Variante 2
gerechnet.
2.1. Voraussichtlicher Umfang der Produktion
und deren Bedarfs nach Marktanteilen
2.1.1. Produktion - Bedarf
Jahr 1981 1982 1983 1984 1985
F 1301 Stück -- 20 300 500 500
(DDR) Nullserie
2.1.2. Sicherung der NSW-Importunabhängigkeit
Der Fernschreiber F 1301 soll spätestens ab Produktionsbeginn
mit Bauelementen und Materialien bestückt werden, die in der
DDR und im SW hergestellt werden.
2.1.3. Erhöhung der Exportfähigkeit und zu erschließende Märkte
Ein Export des Erzeugnisses ist z.Zt. nicht vorgesehen.
Sollte im Laufe der nächsten Jahre Abstimmungen zur An-
wendung des Gerätes im Rahmen des Warschauer Vertrages zu-
stande kommen, wird der Export ausschließlich in dessen
Mitgliedsländern erfolgen.
Dadurch wurde sicher der Bedarf wesentlich erhöhen.
2.2. Materialökonomie
Bei den Fernschreiber F 1001, F 12001 und F 1301 handelt
es sich um eine neue Generation elektron. Fernschreiber im
SW. Zur Zeit existieren in den RGW-Ländern keine vergleich-
baren Erzeugnisse.
Aus diesem Grund ist für alle 3 Varianten der Nachweis der
Senkung des spezifischen Material- und Energieverbrauchs
auf der Basis eines Vergleichserzeugnisses nicht möglich.
2.3. Arbeitsproduktivität
Arbeitsproduktivität und AZA: Einschätzung in Std./Stück
Vorfer- Leiter- Montage Prüfung Gesamt
tigung platten
Variante 1 74,7 16,8 82,8 26,7 201,0
Variante 2 83,8 20,3 94,5 29,9 228,5
Beim Prozeßgebiet "gedruckte Schaltung" ist kein Prüf-
anteil enthalten, da die gesamte Prüfung über Prüfautomaten
mit rechnergestützter Steuerung und rechnergestützter Fehler-
lokalisierung zentral im Bereich Geräteprüffeld aufgebaut
ist.
2.4. Fertigungsmittel - Kosten - Einschätzung in TM
mechanische VWL elektrische Prüfmittel Gesamt
handelsüblich Eigenbau
250 50 95 395
Davon ausgehend, daß beim F 1301 ein sehr großer Wiederholteil-
grad vorhanden ist, werden für die Produktion des F 1301
relativ wenig technologische Vorleistungen benötigt.
2.5. Anteil der Fertigungsverfahren (in % vom AZA)
Fließ- Schiebe- GSF Werkstatt-
fertigung takt fertigung
Vorfertigung - - 1,1 98,9
LP-Fertigung - 75, 0 25,0 -
Montage 33,0 26,0 17,0 24,0
Prüfung - 18,2 9,4 72,4
Summe,
bezogen auf
Gesamt-AZA 13,7 19,8 10,9 55,6
Die Anlaufkosten für den F 1301 wurde mit 35 TM eingeschätzt.
2.6. Kosten- und Preisvorgabe
Die Preisbildung erfolgt nach § 8 der zßKr (Schreiben vom
2.8.77, Jrl-Nr. 2768/77, Tz 2 der VVB NuM in Auswertung
des Ministerratsbeschlusses, "Festlegungen zur Stimulierung
der Forschung, Entwicklung, Produktion und Anwendung moderner
elektronischer Bauelemente, insbesondere der Mikroelektronik")
v. 30.6.1977.
Vorgabe der Kostenelemente (Stand K 1) präz. 11/78
Grundmaterial (PB 1977) 13 685,- M 13 415,- M
Grundlohn 836,- M 906,- M
Gesamtselbstkosten 23 149,- M 23 215,- M
kalkulst. Gewinn 2 693,- M 2 958,- M
Nutzen aus SKS (4 Jahre je 2,7 %) 3 208,- M 627,- M
BP = IAP 29 050,- M 26 800,- M
Die Kostenstruktur beinhaltet die Eigenfertigung des Schritt-
motors und der Tastatur, da die vorgesehenen Kooperationsbe-
ziehungen noch nicht hergestellt werden konnten.
2.7. Themenkostenlimit /TM) und F/E-Amortisation
2.7.1. Themenkostenlimit TM
Gesamt 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Ausgaben F/E 2505 500 570 600 320 290 225 -
davon
themengeb. GM 70 - 5 20 20 25 - -
Anlaufkosten 35 - - - - - 35 -
Ausgaben f. W/T 2540 500 570 600 320 290 260 -
darunter aus
W/T Fonds 2540 500 570 600 320 290 260 -
Basierend auf den Wiederholteilgrad von 95 % des F 1301 und
F 1001 werden bei der Entwicklung des F 1301 die Ergebnisse
von F/E und Technologie des F 1001 weitestgehend wiederver-
wendet.
2.8. F/E-Amortisation
Entwicklungsaufwand 2 540 TM
Amortisation/Gerät 3 019 M
notwendige Prod.-Stückzahl 840 Stck.
zur vollen Amortisation = ca. 2 Prod.-jahre
Der schnelle Rückfluß der Entwicklungsaufwendungen beim Fern-
schreiber F 1301 trotz der relativ geringen Prod.-Stückzahlen
ist darauf zurückzuführen, daß der Wiederholteilgrad des Er-
zeugnisses gegenüber dem Fernschreiber F 1001 bei ca. 95%
liegt.
3. Abschlußplan und Potentialeinssatz
3.1. Haupttermine
Arbeitsstufen Termine Anzahl der Geräte
K 1 (Verteidigung) 10.77
K 2 (Verteidigung) 11.78 3
K 3 (Konstruktion) 1.79
K 4 (Musterbau) 9.79 - Ende 8. Gerät 8
K 5 (Verteidigung) 7.80
K 7 (Musterbau) 1.81 - Ende 2
K 8 (Erprobung) 6.81
K 9 (Nullserienbau) 3.82 - Ende 20
K 10/0 8.82
(Abschlußverteidung)
K 11 (Ausstoß 1. Serie) 1983 500
Die K 7-Muster sind nur Zeichnungskontrollmuster und ver-
bleiben im KMWZ. Es erfolgt hierzu keine Erprobung gemäß
Erprobungsprogramm (festgelegt in Anlage 2 vom Wirtschafts-
vertrag zur Durchführung militärischer F/E-Vorhaben, Ver-
tragsnr. 77-82/1-14/5-04 vom 10.8.77).
3.2. Potenzialeinsatz
Beschäftigte für F/E (VbE)
gesamt 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
11,8 16,2 23,6 18,2 19,5 10,0 5,1
davon in
F/E 11,8 14,9 19,5 9,3 7,1 6,6 3,0
HS 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,0
FS 3,3 4,8 3,6 3,6 3,0 2,7 2,0
Die F/E-Kapazität für 1983 ist vorrangig als Fertigungsbe-
treuungskapazität geplant.
Vertrauliche Verschlußsache
KR-2/1-52/77
16. Ausfertigung 18 Blatt
P f l i c h t e n h e f t T e i l II
Bezeichnung des Erzeugnisses: Elektronischer Fernschreiber F 1301
Verantwortlicher Themenleiter: Dipl.-Phys. Müller
Komplexthemenleiter: Ing. Glöckner
Themenlaufzeit: Themenbeginn K 1 1977
Themenabschluß K 10/0 1982
(Verteidigung)
Produktions- (Ausstoß
aufnahme 1. Serie) 1983
Der Teil II des Pflichtenheftes wird bestätigt.
Zwönitz 13.10.1977 Hofmann
Ort Datum Direktor für F/E
1. Wissenschaftlich-technische Zielstellung
1.1. Anwendungsforderungen
Grundlage für die Entwicklung des elektronischen Fernschreibers
für spezielle Verwendung F 1301 ist der zwischen Auftragnehmer
und Auftraggeber abgeschlossene Wirtschaftsvertrag 77-82/1-14/5-04.
Der Fernschreiber für spezielle Verwendung F 1301 ist eine
3-Registervariante des zivilen Fernschreibersystems F 1000
und muß die Zusatzforderungen der Sonderbedarfsträger erfüllen.
Für den F 1301 wird die konzeptionelle Lösung des zivilen Fern-
schreibers F 1001 voll übernommen. Dies trifft insbesondere für
die Beständigkeit gegen klimatische und mechanische Beanspru-
chungen des Fernschreibers zu.
Technisch abweichende Lösungen sind die zu erfüllenden
speziellen Forderungen des Sonderbedarfsträger bedingt.
- Kurzcharakteristik des Fernschreibers F 1301
Der Fernschreiber F 1301 ist ein elektronischer Blattfern-
schreiber mit Lochbandgerät. Er arbeitet im Internationalen
Telegrafenalphabet Nr. 2 mit Telegrafiegeschwindigkeiten
umschaltbar 50, 75, 100 Bd in Stand- und Wählverbindungen.
Schriftart: lateinische und kyrillische Großbuchstaben
(Zeichenvorrat 78 druckbare Zeichen)
Papier: Rolle glatt
- Einsatzbereich
Der Einsatz des F 1301 erfolgt in behelfsmäßigen und festen
Unterkünften sowie in Spezialfahrzeugen der spezielle Bedarfs-
träger der DDR. Beim Einsatz in Fahrzeugen und in behelfsmäßigen
Unterkünften wird zur Stoßminderung ein Schwingrahen Bestand-
teil des F 1301. Für diese Ausführung werden folgende Kriterien
festgelegt:
. Betriebszustand "betriebsbereit" (Kfz. im Stand): Lokal.,
Übertragungs- und Sonderbetrieb ist möglich.
. Betriebszustand "transportbereit" (Kfz. in Bewegung):
Der Fernschreiber darf nicht in Betrieb genommen werden.
Die Umstellung des F 1301 in einen der genannten Betriebs-
zustände muß ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen möglich sein.
Der F 1301 ist eine selbständige Fernschreibendstelle mit
eigenem Netzanschluß.
Der F 1301 ist an Anschlußleitungen es Vermittlungssystems
TW 55 (TW 39), an Anschlußleitungen eines entsprechenden
Handvermittlungssystems und an Standleitungen anschließbar.
Der Anschluß des F 1301 ist möglich an Zweidraht- und Vier-
drahtleitungen mit Einfachstromtastung.
Zur Vermeidung von Übertragungsfehlern ist der F 1301 mit
einem Fehlerkorrekturgerät (in Vorbereitung) koppelbar.
- Druckprinzip
Spaltenrasterdruck
Vorteile:
. Einfaches Antriebssystem mit Schrittmotoren
. geringe Zahl mechanisch realisierter Funktionen
. hohe Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit
. niedriger Geräuschpegel
Verwendung von Fernschreiberpapier nach TGL 2848 unter
Benutzung von Naturseidenfarbbändern.
- Stanzprinzip
Stanzvorgang und Lochbandtransport erfolgen elektromagnetisch.
- Leserprinzip
Die Lochbandabtastung erfolgt optoelektronisch. Der Lochband-
transport erfolgt mit Schrittmotor.
- Betriebsarten
Mit dem F 1301 sind folgende Aufgaben realisierbar:
. Verbindungsaufbau in Wählnetzen bzw. auf Standleitungen
. Teilnehmeridentifizierung
. Übertragungsbetrieb
+ in Form von Dialogbetrieb
Informationseingabe durch Tastatur, Leser und Kennungsgeber.
Ausgabe der gesendeten und empfangenen Informationen durch
Drucker und/oder Stanzer.
Die ferngesteuerte An- und Abschaltung von Leser und Stanzer
durch Zeichenfolge ist möglich.
Bei Lesersendung führt Gegenschreiben zu Leserstop.
+ in Form von Duplexbetrieb (nur bei Vierdrahtanschluß)
Informationseingabe durch Tastatur, Leser oder Kennungs-
geber.
Ausgabe der empfangenen Informationen durch Drucker und/
oder Stanzer.
Die ferngesteuerte An- und Abschaltung von Leser und
Stanzer durch Zeichenfolgen ist möglich.
. Lokalbetrieb (unabhängig von der eingestellten Telegrafier-
geschwindigkeit wird bei Lokalbetrieb immer mit 100 Bd ge-
arbeitet)
zur Informationserfassung auf Lochband
zur Lochbandduplizierung
zur Klartextausgabe von Lochbändern gespeicherten
Informationen
zum Ausdruck der mit der Tastatur eingegebenen Informa-
tionen (Schreibmaschinenbetrieb)
+ Sonderbetrieb
Nach erfolgtem Verbindungsaufbau ist bei rufender und geru-
fener Station im Sondertastenfeld die Taste "Kodetransparenz"
zu drücken.
Über diese Taste werden alle Steuerfunktionen, die durch 5-Bit-
Kodekombinationen ausgelöst werden und nicht den Drucker be-
treffen, unterdrückt:
Blockierung des Zeichenfolgeauswerters
Blockierung des Kennungsgebers
Blockierung der Klingel
Aufhebung der Stanzunterdrückung
Damit wird die kodefreie Übertragung aller Kodekombinationen
beliebiger 5-Bit-Kodes von Lochstreifen auf Lochstreifen
möglich.
Während der Übertragung eines Spezialtextes kann der Drucker
abgeschaltet werden (manuell mit der Taste "Mitlesesperre").
Die Aufhebung der Sonderfunktion erfolgt manuell und beim
Wiederanlauf der Maschine automatisch.
- Anrufbereitschaft
Der F 1301 ist ständig anrufbereit. Bei einem während des Lokal-
betriebes ankommenden Ruf erfolgt eine akustische Signalisierung
und nach 2- 3 s schaltet der F 1301 automatisch auf Übertra-
gungsbertrieb um. Dabei werden Leser und Stanzer abgeschaltet.
- Mitlesesperre
Der Drucker ist manuell über die Mitlesesperre abschaltbar.
Mit jeder Anwahl oder betriebsmäßiger Anschaltung wird der
Drucker wieder automatisch zugeschaltet.
- Service
Die Reparatur defekter Fernschreiber beim Kunden soll über-
wiegend durch Baugruppenaustausch erfolgen.
Die Reparatur der defekten Baugruppen erfolgt in zentralen
Reparaturwerkstätten.
Der F 1301 erhält eine elektrische Schnittstelle, über die
charakteristische Signale für die Eingrenzung der fehlerhaften
Baugruppen auswertbar sind.
Mittler Fehlersuch- und -behebungszeit ca. 30 min.
- Zuverlässigkeit
Entwicklung und Konstruktion des Fernschreibers müssen so
erfolgen, daß folgende Parameter erreicht werden:
Zeichenfehlerwahrscheinlichkeit ≤ 1 * 10-6
Betriebszuverlässigkeit ≥ 28 * 106 Zeichen
( = 2000 h praktischer
Fernschreibbetrieb)
Der mittlere Ausfallabstand mit ≥ 2000 h
90 %-iger statistischer Sicherheit (= 28 * 106
bei 100 Bd Übertragungszeichen)
Lebensdauer ≥ 350 * 106
Übertragungszeichen
1.2. Allgemeine technische Forderungen
1.2.1. Empfehlungen des CCITT
Bei der Entwicklung des F 1301 sind folgende CCITT-Empfehlungen
zu beachten:
Serie V des CCITT-Weißbuches, Bd VIII/1969:
V 1, V 10, V 11, V 13
Serie S des CCITT-Weißbuches, Bd VII/1969:
S 1, S 2, S 3, S 3 bis, S 3 ter, S 4, S 5, S 6,
S 6 bis, S 6 ter, S 8, S 9, S 11
Serie U des CCITT-Weißbuches, Bd VII/1969:
U 1
Serie F des CCITT-Weißbuches, Bd II-B/1969:
Serie R des CCITT-Weißbuches, Bd II-B/1969:
R 50, R 52, R 60
1.2.2. Nationale Standards, Vorschriften und Anordnungen
TGL 200-0044, Informationsgeräte, Entwurf vom Juni 1976
ABAO 3/1 (GBl. II Nr. 87 Seite 563 vom 20. 7. 66)
ASAO 17/2, ASO 530/1
Ein Standard "Elektronische Fernschreiber" wird im Rahmen der
Entwicklung des F 1001 der Entwicklungsstufen bis K 10 erarbeitet.
1.2.3. Variantenbildung
Die Variantenbildung wird bestimmt durch die verschiendenen Mög-
lichkeiten der Zusammenstellung der konstruktiven Grundeinheiten
(Geräteausrüstung) und durch die Ausrüstung für verschiedene
Fernschreibnetze.
- Geräteausrüstung
Standardausführung Grundgerät mit Tastatur
(Einsatz im Kfz. möglich) Lochbandgerät
Schwingrahmen
Tastaturabdeckung
Abgerüstete Ausführung Grundgerät mit Tastatur
Lochbandgerät
Tastaturabdeckung
- Fernmeldenetzvarianten
Telegrafierwählnetz mit Fernschalteinheit für TW 55
(TW 39) und Handvermittlung
Telegrafiestandleitung mit Fernnetzschalter
Beide Varianten werden durch
Leiterplattenwechsel am Betrei-
bungsort des Gerätes realisiert.
1.3. Klimatische und mechanische Beanspruchungen
1.3.1. Standardmeßbedingungen
Standardschiedsbedingungen nach KMWZ-S 109.101
Tabelle 1 (entsprechend TGL 9203/01)
1.3.2. Einsatzbedingungen (TGL 9200/03)
Einsatzklasse +5/+40/+25/80//2001 nach TGL 9200/03
1.3.3. Verpackungen
Verpackungsart VA 5/VA 6
Technische Forderungen nach RFT-NM 119.000/02
1.3.4. Transport
- Fernschreiber verpackt:
Zulässige Transportbedingungen für Verpackungsart VA 5/VA/6:
Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C
relative Luftfeuchte Umax = 95% bei tUmax = 35°C
mechanische Stöße nach
TGL 200-0057/40 Eb 6 - 25 - 2000
mittlere Transportdauer 5 Monate
- Fernschreiber unverpackt:
Zulässige Transportbedingungen für Fernschreiber mit Schwing-
rahmen im Betriebszustand(Transportbereit (siehe Pkt. 1.1.))
Umgebungstemperatur } entsprechend Einsatzklasse
relative Luftfeuchte } siehe Pkt. 1.3.2.
mechanische Stöße nach
TGL 200-0057/40 Eb 6 - 25 - 8000
Stoßrichtung liegt senkrecht
zur Aufstellfläche des Gerätes.
mechanische Schwingungen
nach TGL 200-0057/04 FA 500-0,075/1
Staubschutz Staubschutzhülle
1.3.5. Lagerung
- Lagerung unverpackt entsprechend Einsatzklasse
+5/+40/+25/80//2001 nach
TGL 9200/03
- Lagerung verpackt,
gemäß Verpackungsart VA 5/
VA 6
Umgebungstemperatur -40°C bis +70°C
relative Luftfeuchte Umax = 90% bei tUmax = 40°C
1.4. Technische Daten
1.4.1. Abmessungen und Masse
Höhe ca. 245 mm
Breite ca. 540 mm
Tiefe ca. 555 mm
Volumen ca. 73 l
Masse ca. 34 kg
Höhe des Kfz.-Schwingrahmens ≤50 mm
1.4.2. Stromversorgung
Netzspannung 220 V +10%, -15%
Bei Unterschreiten des unteren Grenzwertes erfolgt die Abschal-
tung des Fernschreibers.
Netzfrequenz 47,5 Hz bis 63 Hz
Leistungsaufnahme
- im Betriebsruhezustand ca. 12 W
- im Wähl- oder Schreibzustand ca. 130 W
ohne Lochbandgerät
- im Wähl- oder Schreibzustand ca. 185 W
mit Lochbandgerät
1.4.3. Funkentstörung
Funkstörspannung nach Grenzwert ≤ F 1 -20 dB an den
TGL 20885 Bl. 5 Netzanschlüssen
≤ F 1 +10 dB an den
Anschlüssen des Tele-
grafierstromkreises
Funkstörfeldstärke Grenzwert ≤ 50µV/m in 1 m Entfer-
nung bei f = 30 - 790 MHz
Funkstörfestigkeit
Nahfeldstärke E = 20 V/m für 1,5 - 60 MHz
Der F 1301 muß im Nahbereich einer
Sendereinchtung betriebsfähig sein.
Induzierte Spannung U = 20 V für 1,5 - 5 MHz
U = 10 V für 5 - 15 MHz
U = 5 V für 15 - 30 MHz
Die auf angeschlossener Leitung
induzierte Spannungen dürfen nicht
zu Störungen des Fernschreibers
führen.
1.4.4. Funktionelle Parameter
1.4.4.1. Informationseingabe
- Eingabeeinheit Leser
Kennungsgeber
Tastatur
Leser und Kennungsgeber besitzen
die gleiche Wertigkeit. Der Betrieb
der einen Einheit schließt den Be-
trieb der anderen Einheit aus.
Beide Einheiten ist die Tastatur
untergeordnet. Bei Leser/oder Kennungs-
geberbetrieb erfolgt eine optische
Signalisierung der Tastatursperre.
- Leser
Funktionsprinzip optoelektronische Abtastung mit
LED im Start-Stop-Betrieb
Antrieb Schrittmotor
Informationsübergabe bitparallel - zeichenseriell an den
Sender des Fernschreibers
Lochbandbewegung Einzelschritt vorwärts
Dauerschritt vorwärts
Leserabruf Bei betätigter "Vorbereitungs"-Taste
ist Leserabruf über die Zeichenfolge
4 x Kodekombination II/24 von der
Gegenstelle aus möglich.
Lochband nach TGL 24496
Lochung 5spurig
Lochteilung 2,54 mm nach TGL 21584
2,50 mm nach TGL 21584
Kriterien für Betriebs- Leser ein
Bereitschaft Optoelektronik betriebsbereit
Klappe geschlossen
Band eingelegt
Kriterien für Leserstop Bandende
Bandriß
Gegenschreiben bei Ü-Betrieb
Betriebsbereitschafts- LED
anzeige
- Kennungsgeber
Funktion Identifizierung der Fernschreib-
endstelle
Funktionsprinzip vollelektronisch
Zeichenzahl 20, frei kodierbar
Informationsübergabe bitparallel-zeichenseriell an den
Sender des Fernschreibers
Auslösung durch Taste "Hier ist" oder durch
empfangenes "Wer da" (Kodekombi-
nation II/4)
- Tastatur (alphanumerisches
Tastenfeld)
Funktion Zeicheneingabe
Tastaturwahl
Funktionsprinzip vollelektronisch
Informationsübergabe 4reihige Volltastatur
Tastenbelegung lateinische Grundbelegung
Zuordnung der kyrillischen
Buchstaben
Tastenabstand und -versatz
entsprechend TGL 6990 Bl. 1
Registerumschaltung Automatische Umschaltung (auch
manuell möglich) bei lateinisch
Großbuchstaben →→ Ziffern/Zeichen
und bei kyrillisch Großbuchstaben
↑→ Ziffern/Zeichen
manuelle Umschaltung bei
lateinische Großbuchstaben
↑→ kyrillisch
Großbuchstaben
Zeilenendautomatik Vor dem 70. vorschubbildenden Zeichen
einer Zeile wird automatisch sende-
seitig WR und ZL eingeblendet. Das 70.
vorschubbildende Zeichen wird als erstes
Zeichen auf der neuen Zeile abgedruckt
Zwischenraumautomatik In dem am Druckwerk einstellbaren
Zeilenendbereich wird nach einge-
gebenem "Zwischenraum" vor dem fol-
genden vorschubbilden Zeichen
automatisch WR und ZL eingeblendet.
Das vorschubbildende Zeichen wird
als erstes Zeichen auf der neuen
Zeile abgedruckt. Diese Automatik
ist abschaltbar.
Anlaufautomatik Synchronisierung der in Verbindung
stehenden Fernschreiber durch auto-
matisches Einblenden von Bu zu Beginn
jeder Tastatureingabe und nach dem
Wählvorgang.
Tastaturpuffer 16 Zeichen
Bei mehr als 13 abgepufferten Zeichen
erfolgt eine optische Signalisierung
in der Tastatur, die nach dem Erreichen
von nur 5 gepufferten Zeichen wieder
verlöscht. Bei Abpufferung von 16 Zei-
chen erfolgt Tastatursperre, die durch
Drücken der Taste "Pufferentriegelung"
im AN-Tastenfeld aufgehoben wird.
Roll over über 2 Tasten
Daueraussendung Mit den Drücken der Taste wird erst
der Tastaturpuffer geleert und dann
das zuletzt eingegebene Kodezeichen
dauerausgesendet, solange die Taste
gedrückt ist.
Daueraussendung ist über das Zeilen-
ende hinweg möglich.
Neigung der Tastatur 12° 7°
Betätigungskraft > 1,5 N für Einfachtasten
> 2,1 für Mehrfachtasten
Tastaturhub ca. 4 mm
- Tastatur (Sondertastenfeld)
Funktion Funktionstasten
Anzeige optisch mit LED
Tastenanzahl max. 10
Anzahl der optischen
Anzeigen 5
1.4.4.2. Sendekanal
- Sender
Funktion + Anschaltung der Eingabeeinheiten
an den Sender
+ Wandlung der bitparallelen Kode-
zeichen in bitserielle Fernschreib-
zeichen
+ Gegenschreiberkennung
+ Anpassung an das Fehlerkorrektur-
gerät
Start- und Stopschritt- entsprechend den Empfehlungen der
länge Serie S des CCITT- Weißbuches
Bd VII/1969
- Sendewandler
Funktion + Modulieren des Linienstromes
+ Wandlung des geräteinternen Logik-
pegels in den Telegrafiepegel
+ galvanische Trennung von Fern-
schreiberstromkreis und Tele-
grafierstromkreis
- Sendeverzerrung ≤ 2% für die Telegrafiergeschwin-
digkeit 50, 75, 100 Bd ohne Lei-
tungsanpassung
Telegrafierstrom 16 - 70 mA Einfachstrom (Gleichstrom)
Telegrafierspannung max. 130 V (Gleichspannung)
Fremdspannungsfestigkeit Die Telegrafiereingänge des F 1301
sind zu schützen gegenüber
. Falschpolung
. OB-Rufspannung
. ZB-Rufspannung
1.4.4.3. Empfangskanal
- Empfangswandler
Funktion + Wandlung des Telegrafierpegels
in den geräteinternen Logikpegel
+ galvanische Trennung von Fern-
schreibkreis und Telegrafier-
stromkreis
+ Betriebsbereitschaftsanzeige
Grundgerät (LED)
Telegrafierstrom 16 - 70 mA Einfachstrom (Gleichstrom)
Telegrafierspannung max. 130 V Gleichspannung
Fremdspannungsfestigkeit siehe Sendewandler
- Empfänger
Funktion + Wandlung der bitparallelen Fern-
schreibzeichen in bitparallele
Kodzeichen und Übergabe an die
Ausgabeeinheiten
+ Zentraler Taktgenerator
+ Registerauswertung
+ Zeichenfolgeauswertung zur fern-
gesteuerten An- und Abschaltung
von Leser und Stanzer
CCCC = Stanzer ein
FFFF = Stanzer aus
//// = Leser ein (Schrägstrich)
Bei Sonderbetrieb wird Zeichenfolge-
auswertung unwirksam.
Verarbeitbare Stop- entsprechend Empfehlung des CCITT
Schrittlänge
Empfangsspielraum ≥ 48% für 50, 75 und 100 Bd
max. Abweichung von der ± 0,2%
Nennfrequenz des Takt-
generators
1.4.4.4. Informationsausgabe
- Ausgabeeinheiten Drucker
Stanzer
- Drucker
Funktion + Ausgabe der vom Empfänger ange-
botenen bitparallelen Kodezeichen
in Klarschrift
+ Dekodierung und Ausführung der
Steuerfunktion ZW, WR, ZL, VL,
WERDA
Druckprinzip Spaltenrasterdruck
Raster 5 x 7 Punkte
Schriftart Lateinisch Großbuchstaben
Kyrillisch Großbuchstaben
Fernschreibpapier Rollenpapier FLB nach TGL 2848
Breite des Fernschreib- 208 - 216 mm
papiers
Durchmesser der Vorrats- innen: 25 - 27,5 mm
rolle außen: max. 120 mm
Papieraufnahme am Gehäuse des Fernschreibers F 1301
Farbband 13 mm breit, Naturseide
Anzahl der Nutzen bis 3
Zeilenabstand 1fach (4,25 mm) - (4,23 mm)
1,5fach (6,375 mm) - (6,35 mm)
2fach (8,5 mm) - (8,46 mm)
Zeichen pro Zeile 69
Zeichenabstand 2,54 mm
Zeichenvorrat 78 druckbare Zeichen, davon
26 lateinische Großbuchstaben
31 kyrillische Großbuchstaben
21 Ziffern und Zeichen
Schrifthöhe 2,6 mm
Antrieb Schrittmotoren
Druckpuffer 16 Zeichen
Druckunterdrückung Kodekombination II/4 (Werda)
WR/ZL-Automatik vor dem 70. vorschubbildenden
Zeichen einer Zeile führt der
Drucker einen vollgepufferten
automatischen Wagenrücklauf
mit Zeilenvorschub aus
Anlaufautomatik Beim Einschalten des Druckers er-
folgt im Druckwerk automatisch
WR und ZV
Mitlesesperre Durch Taste im Sondertastenfeld
schaltbar, bewirkt Druckunter-
drückung.
Mit erneuter Anwahl bzw. bei jeder
Netzeinschaltung wird die Mitlese-
sperre automatisch abgeschaltet.
Druckenergie 3stufig umschaltbar
Sichtbarkeitsautomatik Die Sichtbarkeit der zuletzt ge-
druckten Zeichen wird erreicht,
indem durch Drücken einer Taste
im Sondertastenfeld automatisch
Zeilenvorschub gegeben wird.
Vor Abdruck weiterer Zeichen wird
das Papier automatisch in die Aus-
gangslage zurückgesteuert.
Papierriß, Papierende, Führt zu Verbindungsabbruch und
Druckpufferüberlauf zur Vorwählerbelegung im Ü-Betrieb
(Havarie) oder zum Ausschalten und zur Vor-
wählerbelegung im Lokalbetrieb.
Anzeige durch LED im Grundgerät.
Nach der Beseitigung der Störung
ist das Gerät neu einzuschalten.
- Stanzer
Funktion Ausgabe der vom Empfänger ange-
botenen bitparallelen Kodezeichen
auf 5-Spur-Lochbänder nach TGL
24496 mit einer Informationsstruk-
tur entsprechend TGL 21584 Bl. 2
Bedienfunktionen:
+ Prüflauf mit Vollausstanzung
+ Einzelschritt rückwärts
+ Stanzer ein- bzw. ausschalten
durch Zeichenfolge von der Gegen-
stelle aus.
CCCC = Einschalten
FFFF = Ausschalten
Stanz- und Transport- Elektromagnete
antrieb
Kriterien für Betriebs- Stanzer ein
bereitschaft Papiervorrat vorhanden
Klappe geschlossen
Betriebsbereitschafts- LED
anzeige
Stanzunterdrückung Kodekombination -/32
Kodekombination II/4 (werda)
Bei Sonderbetrieb (siehe Pkt. 1.1.)
wird die Stanzunterdrückung unwirksam
- Klingel
Funktion akustische Signalisierung bei
+ ankommender Ruf während des
Lokalbetriebes
+ Dekodierung der Kodekombination
II/10 in der Drucklogik
- Betriebsstundenzähler
Funktion Anzeige der Betriebszeit in Stunden
unabhängig von der eingestellten
Schrittgeschwindigkeit
1.4.4.5. Betriebssteuerung
Funktion Steuerung des Zusammenwirkens der
Funktionseinheiten Leser, Stanzer,
Fernschalteinheit oder Fernnetz-
schalter, Sondertastenfeld und
Empfänger sowie Fehlerkorrektur-
gerät und Sonderfunktionen
1.4.4.6. Anschalttechnik
- Anschalttechnik für Standleitungen
Funktion Netzseitiges Ein- und Ausschalten
des Fernschreibers bei Betrieb
auf Standleitungen
Anschaltung Entweder mit dem Empfang der ersten
Kodekombinationen oder durch Drücken
der Netztaste im Sondertastenfeld
des Fernschreibers
Abschaltung Wenn 45 - 60 s keine Zeichen über-
tragen werden
ankommender Ruf während akustische Signalisierung
des Lokalbetriebs 2 - 3 s nach Empfang eines Anrufes
erfolgt die automatische Umschaltung
in den Übertragungsbetrieb
- Anschalttechnik für Wählleitungen
Funktion Verbindungsauf- und -abbau für Wähl-
verbindungen, vorerst für Vermitt-
lungssystem TW 55 u.ä. Vermittlungs-
system sowie Handvermittlung durch
die Fernschalteinheit
Teilnehmerwahl Erfolgt durch Drücken der entsprechen-
den Zifferntasten im Schreibtastenfeld
Elektronische Umformung in Nummern-
schalterimpulse entsprechend der Em-
pfehlung U2 des CCITT-Orangebuches.
ankommender Ruf während akustische Signalisierung, 2 - 3 s
des Lokalbetriebes nach Empfang eines Anrufes
erfolgt die automatische Umschal-
tung in den Übertragungsbetrieb.
Verhalten bei Drahtbruch Übergang in den Betriebsruhezustand
in der Teilnehmerschleife
Erkennung von Wählauf- Optische Signalisation von ankommen-
forderung: den Wähleraufforderungen.
Erkennung von beliebig vielen
Wählaufforderungen
Verbindungsabbau: Nach Erkennung der Schlußzeichen-
betätigung vom Amt erfolgt Übergang
in den Betriebsruhestand
Betriebsruhezustand bei Es fließt kein Betriebsruhestrom
Handvermittlung:
Verhalten bei Netzausfall Automatische Vorwählerbelegung 1 s
an der Fernscheibend- nach Beginn des Netzausfalls
stelle (Automatik ist abschaltbar)
Anschlußbedingungen Anschluß an Vermittlungssystem
TW39/55, Kennzeichen entsprechend
System B der CCITT
Anschluß an entsprechende Hand-
vermittlungssysteme
1.4.4.7. Stromversorgung
Funktion Stromversorgung der für den jewei-
lien Betriebsfall erforderlichen
Baugruppen
Aufbau Aufteilung in 3 Teile, damit für die
charakteristischen Betriebsfälle ein
minimaler Leistungsverbrauch erreicht
wird.
Bereitschaftsnetzteil:
zur Versorgung der für den Bereit-
schaftslauf erforderlichen Baugruppen
Betriebsnetzteil:
Zur Versorgung des Grundgerätes
im Betrieb
Netzteil im Lochbandgerät:
Zur Versorgung der abrüstbaren
Einheit Lochbandgerät.
Bereitschaftsnetzteil und Betriebs-
netzteil sind Bestandteil der Bau-
gruppe Netzteil im Grundgerät.
Das Netzteil für Lochbandgerät
ist Bestandteil des Lochbandgerätes.
1.5. Konstruktionsausführung
1.5.1. Spezielle Forderungen zur Konstruktion
- Formgebung
Ausführung Tischgerät
Formgestalter INT Berlin
Gestaltungskriterien Die gedruckten Informationen müssen
während der Klartextausgabe bei
Tastatureingabe sichtbar sein.
Minimaler AZA für Gehäuseteile
durch Plasteinsatz.
- Bedienforderungen Einfacher und übersichtlicher Auf-
bau der Bedienfelder und Anzeige-
elemente.
Die Bedienung des FS soll ohne
besondere fachliche Qualifikation
erlernbar sein.
Bedienfehler dürfen nicht zur Zer-
störung von Einrichtungen führen.
- Serviceanforderungen Konsequente Realisierung der Bau-
gruppenhinweise.
Einfache Austauschbarkeit der
Baugruppen.
Baugruppenaustausch muß mit wenigen
Werkzeugen möglich sein.
Ausführung der Befestigungselemente
als unverlierbare Teil.
Wartungsfreier Betrieb
Mittlerer Fehlersuch- und -behebungs-
zeit ca. 30 min.
Vereinfachung der Fehlersuche durch
Realisierung eines Service-Steck-
verbinders mit charakteristischen
Signalen.
- Anschluß von externem wird elektronisch und konstruktiv
Wecker und Fehlerkor- vorbereitet
- Anbau von Tastatur und Tastatur und Lochbandgerät werden
Lochbandgerät mechanisch fest mit dem Grundgerät
verbunden.
Die elektrische Verbindung erfolgt
über Steckverbinder.
- Farbgestaltung stimmt mit der des zivilen Fern-
schreibers überein
- spezielle Forderungen + Möglichkeit der Befestigung des
beim Einsatz mit Kfz. F 1301 auf Tischplatte mit
Schwingrahmen
Tischplattenabmaße 20 mm dick
600 mm tief
+ Die Tastatur ist abzudecken.
Die Druckerpapierrolle
ist gegen ausheben zu sichern.
Die konstruktive Ausführung des F 1301
muß zu ca. 95% auf die Konstruktion
des zivilen Fernschreibers F 1001
aufbauen.
1.5.2. Forderungen für den Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz
- Schutzgüte entsprechend ABAO 3/1
- Schutzgrad IP 20
IP 00 im Druckraum nach TGL 15165 Bl. 1
- Schutzklasse Schutzklasse I nach TGL 21366
- Elektrische Trennung der Netzstromkreis 1500 V/50Hz
Stromkreise/Prüfspannung Telegrafierstromkreis und sonstige
Stromkreise 500 V/50 Hz
- Kriech- und Luftstrecken Netzstromkreis Gruppe 4 }
Telegrafier- }
stromkreis Gruppe 3 } TGL 16559
sonstige Strom- }
kreise Gruppe 3 }
- Schalldruckpegel Zielwert mit Lochbandgerät
in 1 m Abstand ca. 60 dB (AI)
Zielwert ohne Lochbandgerät
≤ 55 dB (AI)
1.5.3. Verpackung
- Verpackungsart VA 5/VA 6 Technische Forderungen RFT-NM
119.000/02
- Einzelverpackung in PUR-Füllschaum
1.5.4. Umfang der Konstruktionsdokumentation
entsprechend RFT-NM 014
1.6. Zielwerte für die Zuverlässigkeit
Zeichenfehlerwahrschein- ≤ 1 * 10-6
lichkeit
Betriebszuverlässigkeit ≥ 28 * 106 Zeichen (= 2000 Std.
praktischer Fernschreibbetrieb)
der mittlere Ausfallabstand mit ≥ 2000 h
90%iger statistischer Sicherheit bei (= 28 * 106
100 Bd Übertragungszeichen)
Lebensdauer ≥ 350 * 106
Übertragungszeichen
1.7. Technologische Aufgaben und Ziele
Die technologischen Aufgaben und Ziele für den Komplex der Fern-
schreibtechnik wurden in der VVS KR-2/1-37/77 "Prognose der Fern-
schreibtechnik" konzipiert.
2. Formgestalterische Zielstellung
Mit der Übernahme der Gesamtkonzeption wird auch die Formgestal-
tung und Farbgebung von Fernschreiber F 1001 übernommen. Die form-
gestalterische Bearbeitung erfolgt im INT Berlin.
Abweichungen durch Forderungen des Sonderbedarfsträger werden
zweckentsprechend berücksichtigt, wobei zusätzliche Formgetal-
terische Arbeiten nicht notwendig sind.
3. Erfinderische und schutzrechtliche Zielstellungen
Für den F 1301 gilt die Schutzrechtskonzeption des Fernschreibers
F 1001, die in Form der VD 3/9/77 vorliegt.
4. Absatz- und Servicebedingungen
4.1. Absatz
Der Einsatz des Fernschreibers F 1301 erfolgt ausschließlich bei
Sonderbedarfsträgern der DDR.
4.2. Service
Entsprechend dem internationalen Trend wird der Service wie beim
F 1001 durch Baugruppenaustausch beim Anwender realisiert. Die
Reparatur der Baugruppen wird in Zentralwerkstätten durchgeführt.
Der F 1301 erhält eine elektrische Schnittstelle, über die charak-
teristische Signale für die Eingrenzung der fehlerhaften Baugruppe
auswertbar sind.
Die mittlere Fehlersuch- und Behebungszeit beträgt ca. 30 min.
Spezielle Servicebedingungen sind zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer vertraglich zu regeln.
Kombinat VEB Meßgerätewerk Zwönitz Vertrauliche Verschlußsache
9417 Zwönitz, Schillerstr. 13 KR-2/1-59/78
22. Ausfertigung 1 Blatt
2. Ergänzung zum Pflichtenheft Teil I des Fernschreibers F 1301
In Abstimmung mit dem ASMW wird der Teil I ergänzt und es werden
technische Daten vom Teil II in den Teil I übernommen.
1. Schalldruckpegel in 1 m Abstand ca. 60 dB (AI)
mit Lochbangerät
2. Betriebszuverlässigkeit ≥ 2000 h
Der mittlere Ausfallabstand mit (= 28 * 106
90%iger statistischer Sicherheit Übertragungszeichen)
bei 100 Bd
3. Die Frühausfallphase ist im Betrieb
abzufangen.
4. Mittlere Reparatur 30 min.
5. Lebensdauer ≥ 350 * 106
Übertragungszeichen
6. ANG-Kosten ≤ 8,80M/TM IWP
7. Rückweisquote der Endkontrolle ≤ 0,5
an die Produktion
8. Für kontrollfähige Fertigungsabschnitte sind Fehlerquote und
AN-Limits zu ermitteln und als "Grundlage der Qualitätsent-
lohnung" vorzugeben.
Folgend Präzisierung sind notwendig:
Blatt 3: Volumen des F 1301 mit ca. 73 l
Lochbandgerät
(ohne Schwingrahmen)
Masse des F 1301 mit ca. 34 kg
Lochbandgerät
(ohne Schwingrahmen)
Blatt 6: Kosten- und Preisvorgabe
Neuer Test
Vergabe der Kostenelemente (Stand K 2)
Grundmaterial und technolog. Koop. 13.415,- M
Grundlohn 906,- M
Gesamtselbstkosten 23.215,- M
kalk. Gewinn 2.958,- M
Nutzen aus SKS 627,- M
BP _ IAP 26.800,- M
Zwönitz, den 19.10.1978
Kombinat VEB Meßgerätewerk Zwönitz Vertrauliche Verschlußsache
9417 Zwönitz, Schillerstr. 13 KR-2/1-60/78
16. Ausfertigung 3 Blatt
Ergänzung zum Pflichtenheft des Fernschreibers F 1301
Folgende Änderungen, Präzisierungen bzw. Ergänzungen sind in
Auswertung der K2 - Erprobung des F 1301 im KMWZ sowie beim
Sonderbedarfsträger erforderlich:
In den o.g. Dokumenten sind die Änderungen realisiert.
Zwönitz, den 12. 10.1978